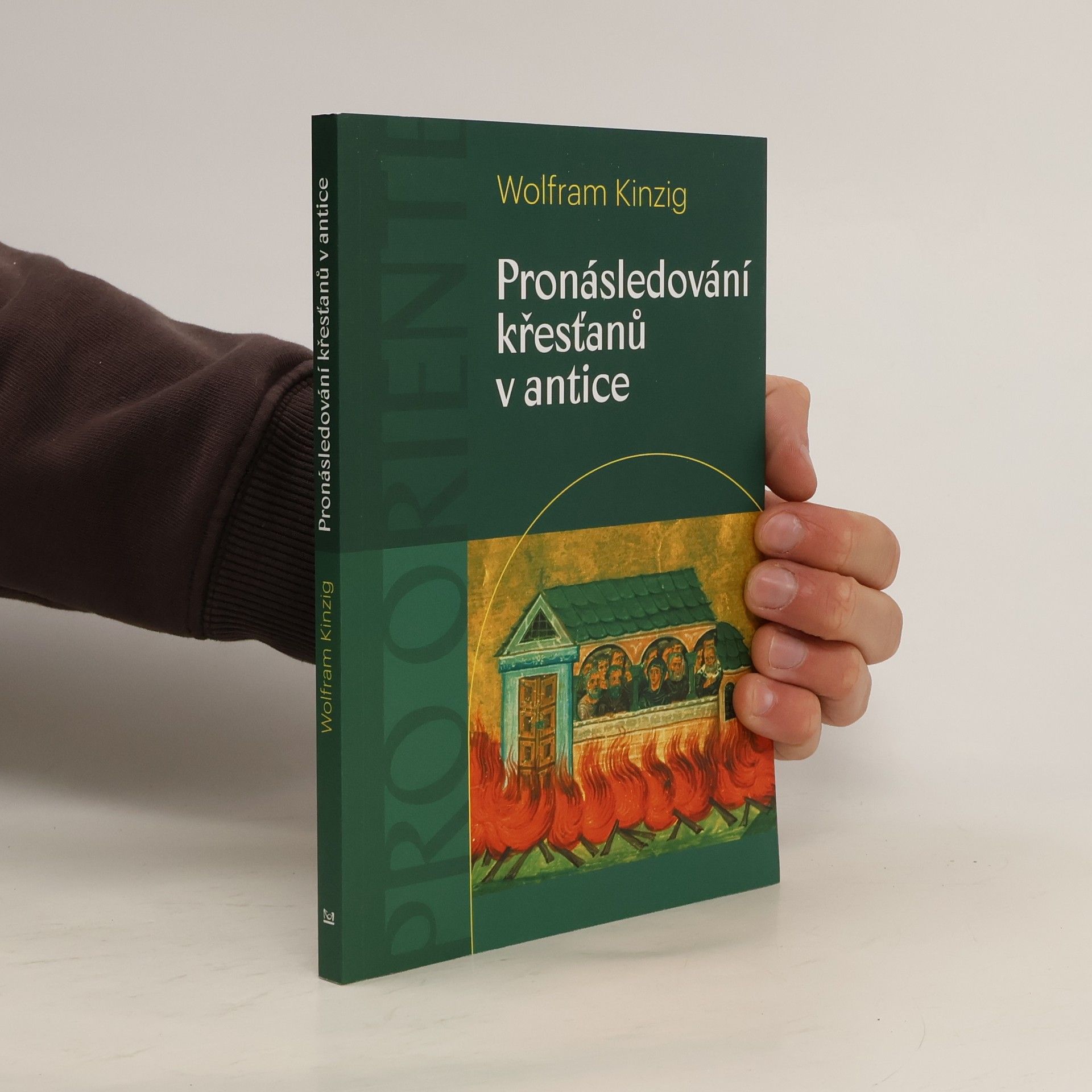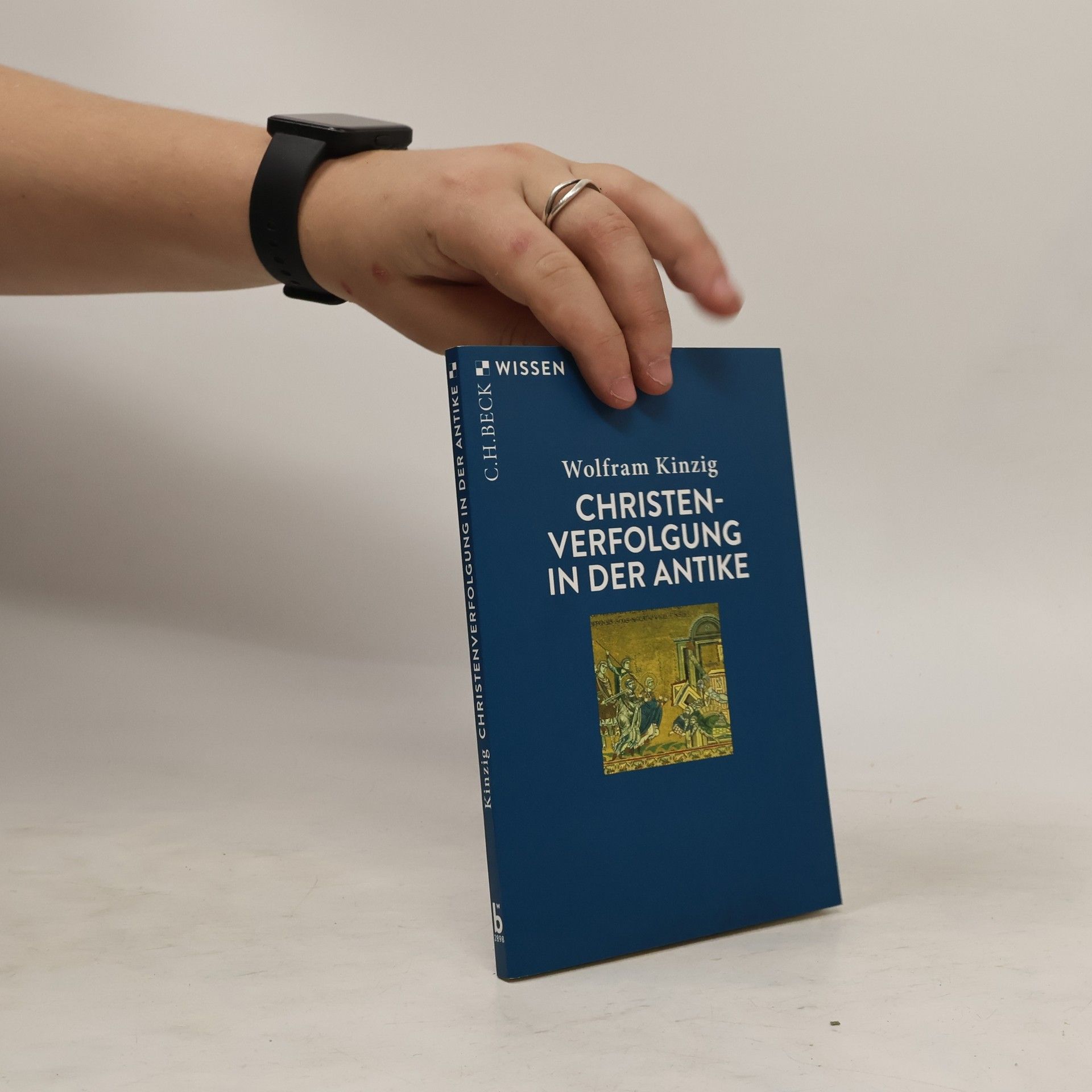A History of Early Christian Creeds
- 768pagine
- 27 ore di lettura
Focusing on the evolution of early Christian creeds, this book provides a comprehensive examination of their origins and progression from the credal texts found in the New Testament to the established classical formulas of the fourth century. It delves into the theological implications and historical context surrounding these creeds, offering insights into their significance in shaping Christian doctrine and community beliefs throughout history.