Spätestens seit dem Aufkommen der völkischen PEGIDA und der AfD ist klar, dass politisches System und Gesellschaft der DDR aus dem Kontext des historischen Nationalsozialismus wie des gegenwärtigen Rechtsradikalismus genauso wenig herausgelöst werden können, wie die alte und neue Bundesrepublik. Ein Klima ist entstanden, in dem bislang ignorierte oder verdrängte Konfliktlinien der deutschen Mehrheitsgesellschaft – wie der Umgang mit Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus – deutlich zutage treten. Einige Historiker, Politiker sowie Bürgerrechtler instrumentalisieren die DDR-Aufarbeitung sogar für ihr rechtspopulistisches Engagement. Das Buch fasst wesentliche Ergebnisse der Tagung „Nach Auschwitz: Schwieriges Erbe DDR“ vom Januar 2017 zusammen. Es versteht sich als ein Plädoyer für eine intensivere Hinwendung der Zeitgeschichtsforschung wie der politischen Bildung zur Untersuchung und Kritik der SED-Diktatur als einer von drei Nachfolgegesellschaften des Nationalsozialismus. Herausgegeben im Auftrag der Amadeu Antonio Stiftung sowie der Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen (Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten).
Enrico Heitzer Libri
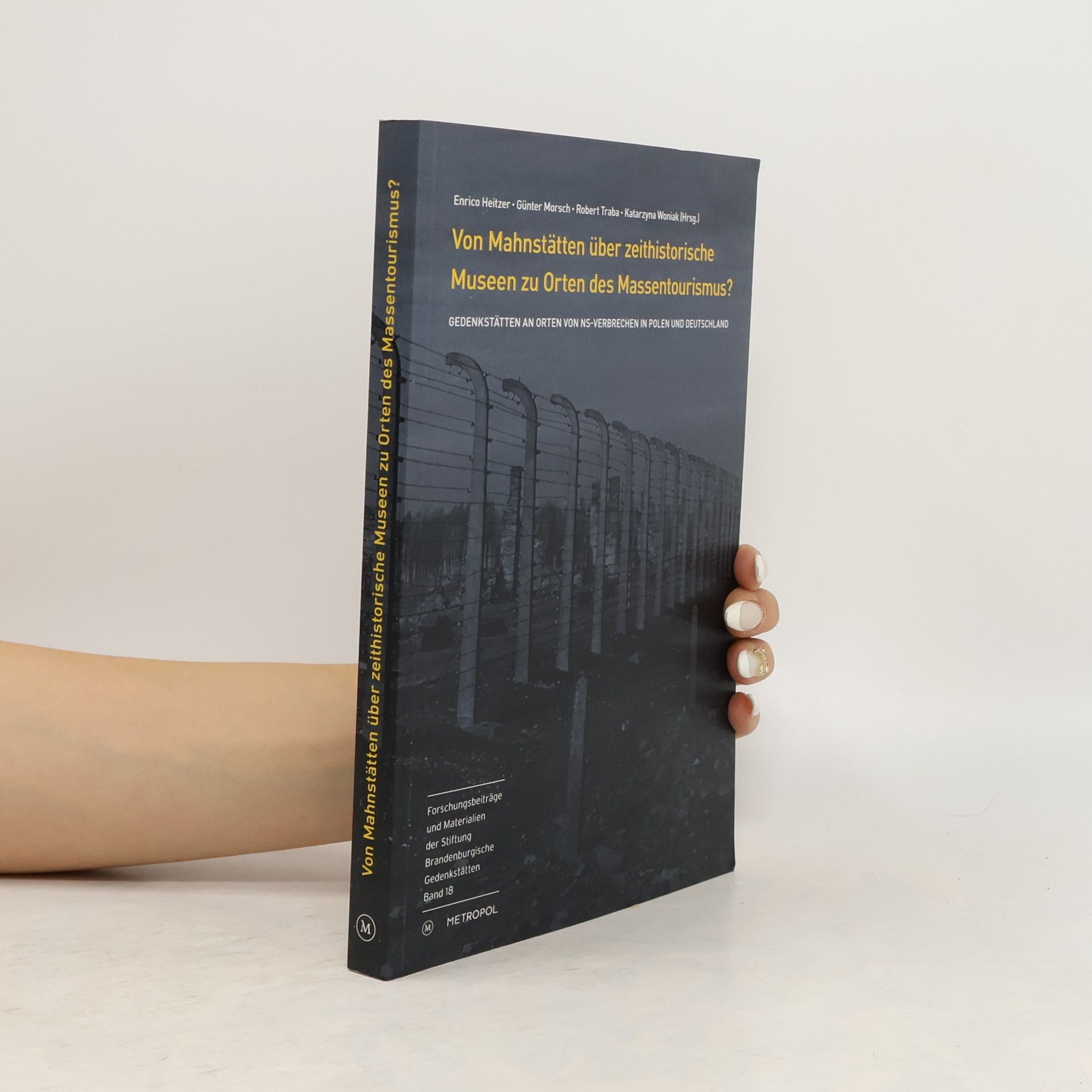
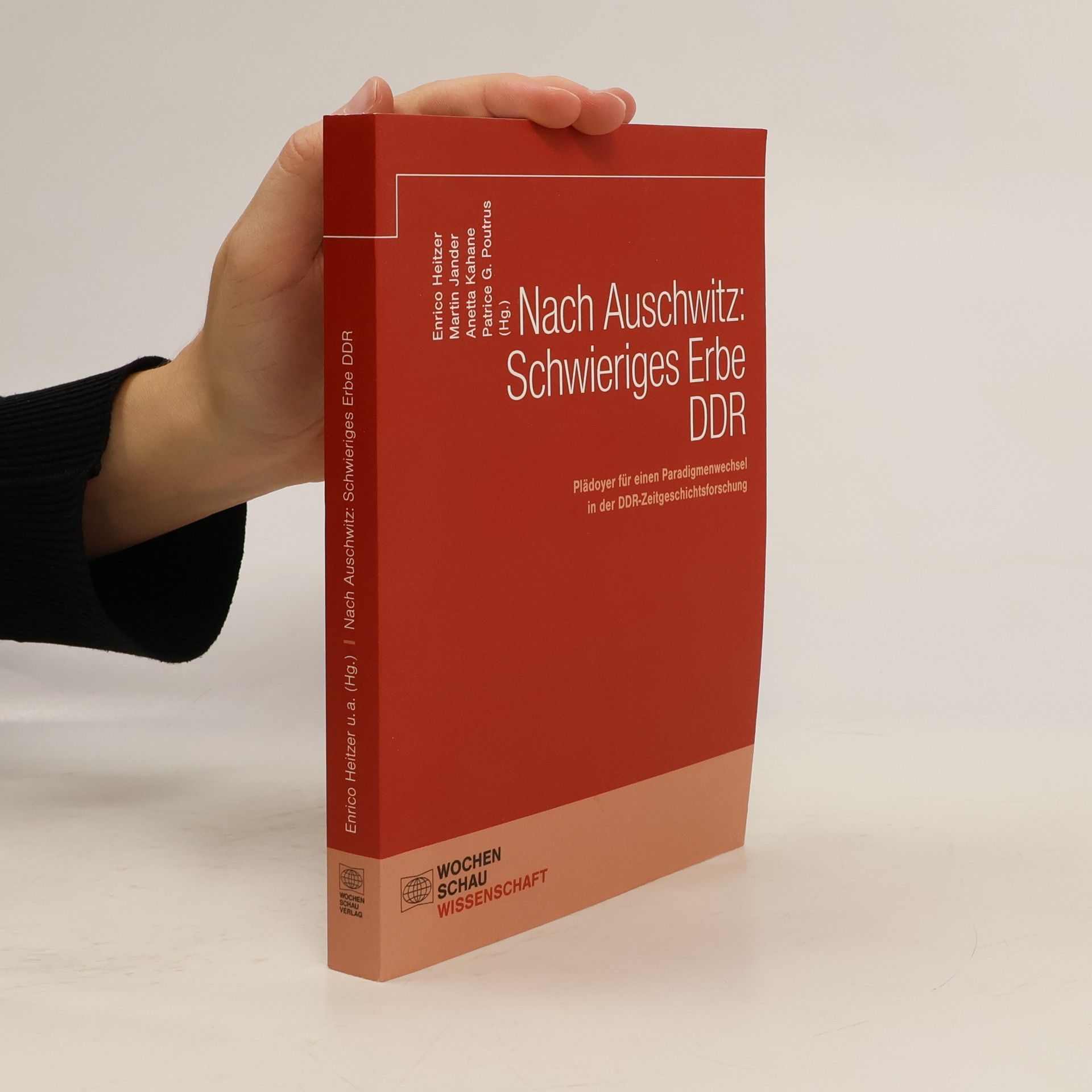
Unter grundsätzlich unterschiedlichen Ausgangsbedingungen entstand in Polen, in der DDR sowie der Bundesrepublik Deutschland nach 1945 eine Vielzahl von Gedenkstätten, Museen und Mahnmalen, die an die deutschen Verbrechen in der Zeit der NS-Diktatur erinnern. Nach 1989/90 kam es sowohl in Polen als auch in Deutschland zu einer gesellschaftlichpolitischen Neubestimmung der Rolle der NS-Gedenkstätten. Mit dem zunehmenden Abstand zu den historischen Ereignissen, mit dem Sterben der Zeitzeugen und unter neuen politischen Rahmen bedingungen veränderten sich die Gedenkstätten in beiden Ländern sehr stark. Der Band dokumentiert die Beiträge einer polnisch-deutschen Tagung, die den 70. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges zum Anlass nahm, eine Zwischenbilanz der jeweiligen erinnerungskulturellen Entwicklung zu ziehen. Polnische und deutsche Historiker und Gedenkstättenexperten nutzten die vom Zentrum für Historische Forschung Berlin (PAN) und von der Gedenkstätte Sachsenhausen organisierte Konferenz, um kritisch über den Funktions- und Bedeutungswandel der Gedenkstätten und über die Zukunft der Erinnerungskultur in beiden Nachbarländern zu diskutieren.