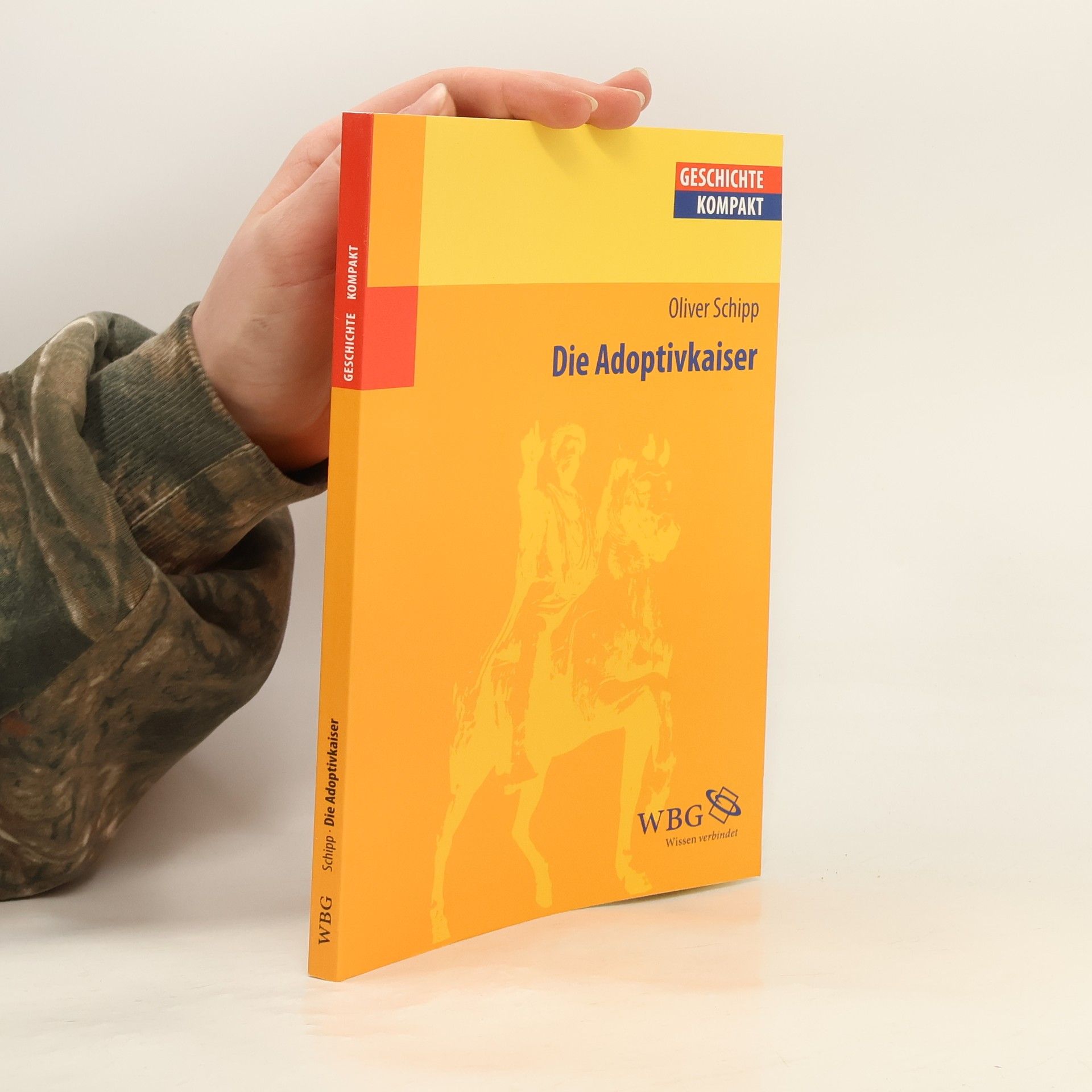Den Kolonat neu denken
Zur Aktualität eines Forschungsproblems
Die Untersuchung widmet sich der Frage nach der Entstehung und der Entwicklung des Kolonats. Dazu werden erstmals strukturelle Rahmenbedingungen und kontingente Faktoren untersucht, welche mittels der Gesetzgebung den Kolonat bedingten, etwa der politisch-legislative Rahmen, innere wie äußere Kriege sowie Veränderungen der klimatischen Bedingungen. Die Kolonengesetze der Spätantike sind nach der hier vertretenen Ansicht nicht das Ergebnis einer progressiven Entwicklung, die zum Kolonat führte, sondern der Anfang eines Prozesses, in dessen Verlauf sich der Kolonat herausbildete. Mit der Regierung Konstantins des Großen, so die These, begann für die Kolonen die verhängnisvolle Entwicklung ihres personenrechtlichen Status.