Alf Lüdtke Libri
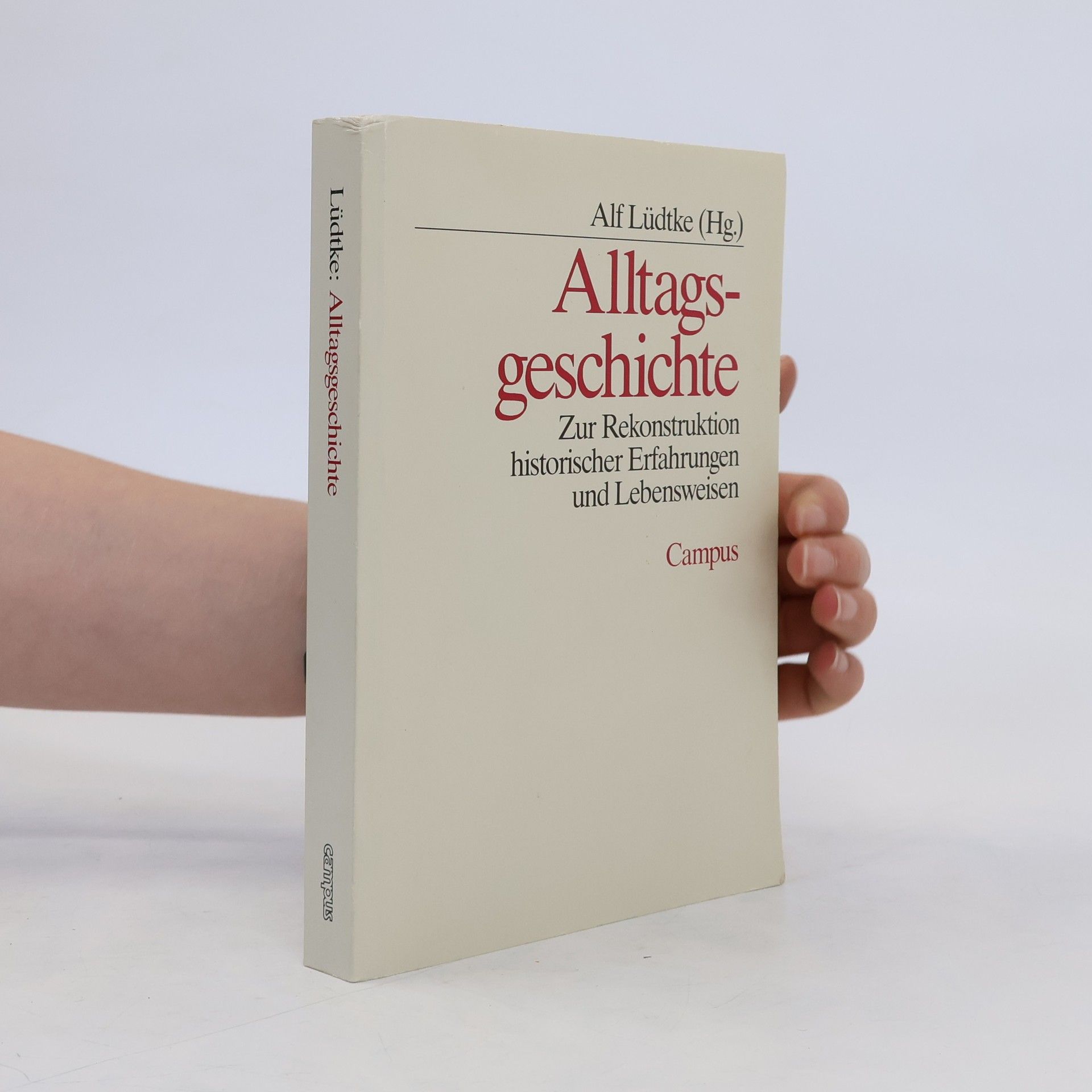
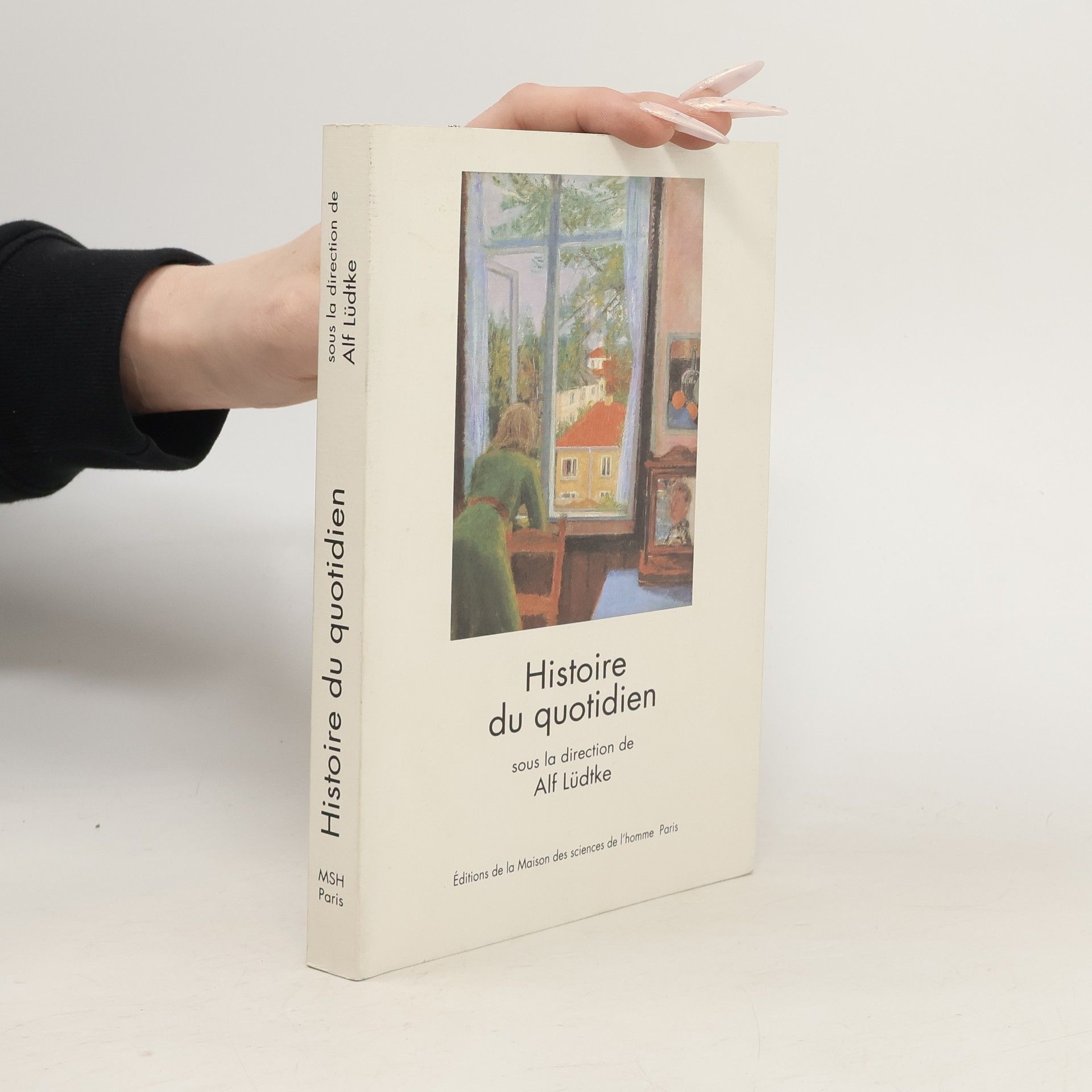

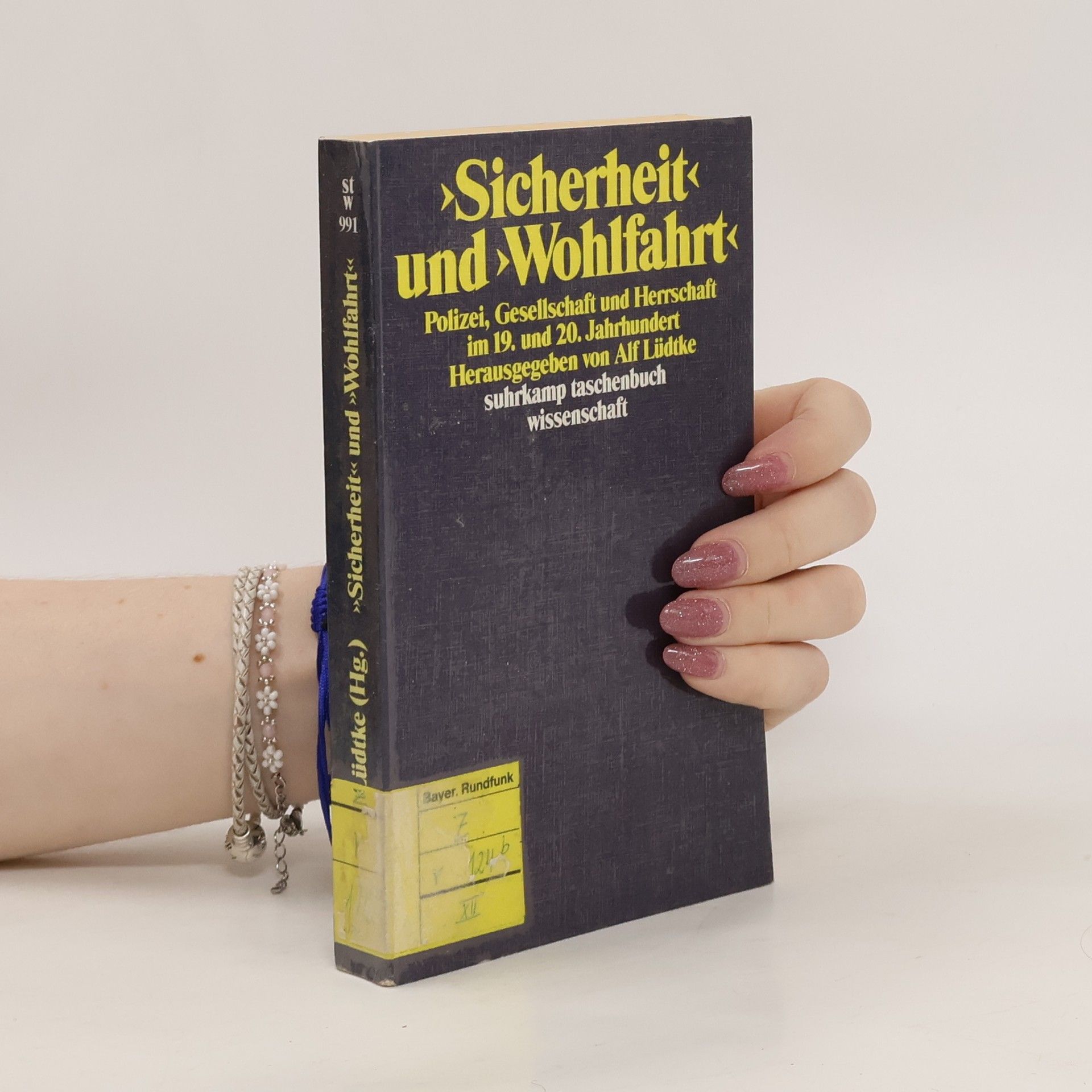
Der Band versammelt grundlegende Texte von Alf Lüdtke, überwiegend aus der Hochzeit der Alltagsgeschichte. Mit dem Fokus auf scheinbar nebensächliche Aspekte des Arbeiteralltags leuchtet er die Frage nach dem Eigen-Sinn der verschiedenen Akteure aus. So gelang es ihm gängige ysekategorien aufzubrechen und neue Perspektiven auf das Handeln Einzelner wie auch ganzer Gruppen zu entwickeln. Mit der Neuauflage des Buches wird der Fachdisziplin und der interessierten Öffentlichkeit ein hoch informatives Lesevergnügen wieder zugänglich.
Histoire du quotidien
- 341pagine
- 12 ore di lettura
Au revers de la "grande histoire", telle qu'on l'enseigne et qu'on la pratique encore souvent aujourd'hui, des historiens et chercheurs allemands s'interrogent sur la possibilité d'écrire une autre histoire, plus proche de ces acteurs que l'historiographie traditionnelle présente comme de simples objets, plus proche des réalités sociales et culturelles du peuple et de son existence de tous les jours, afin de composer l'image d'une histoire du quotidien en devenir.
Alltagsgeschichte
Zur Rekonstruktion historischer Erfahrungen und Lebensweisen