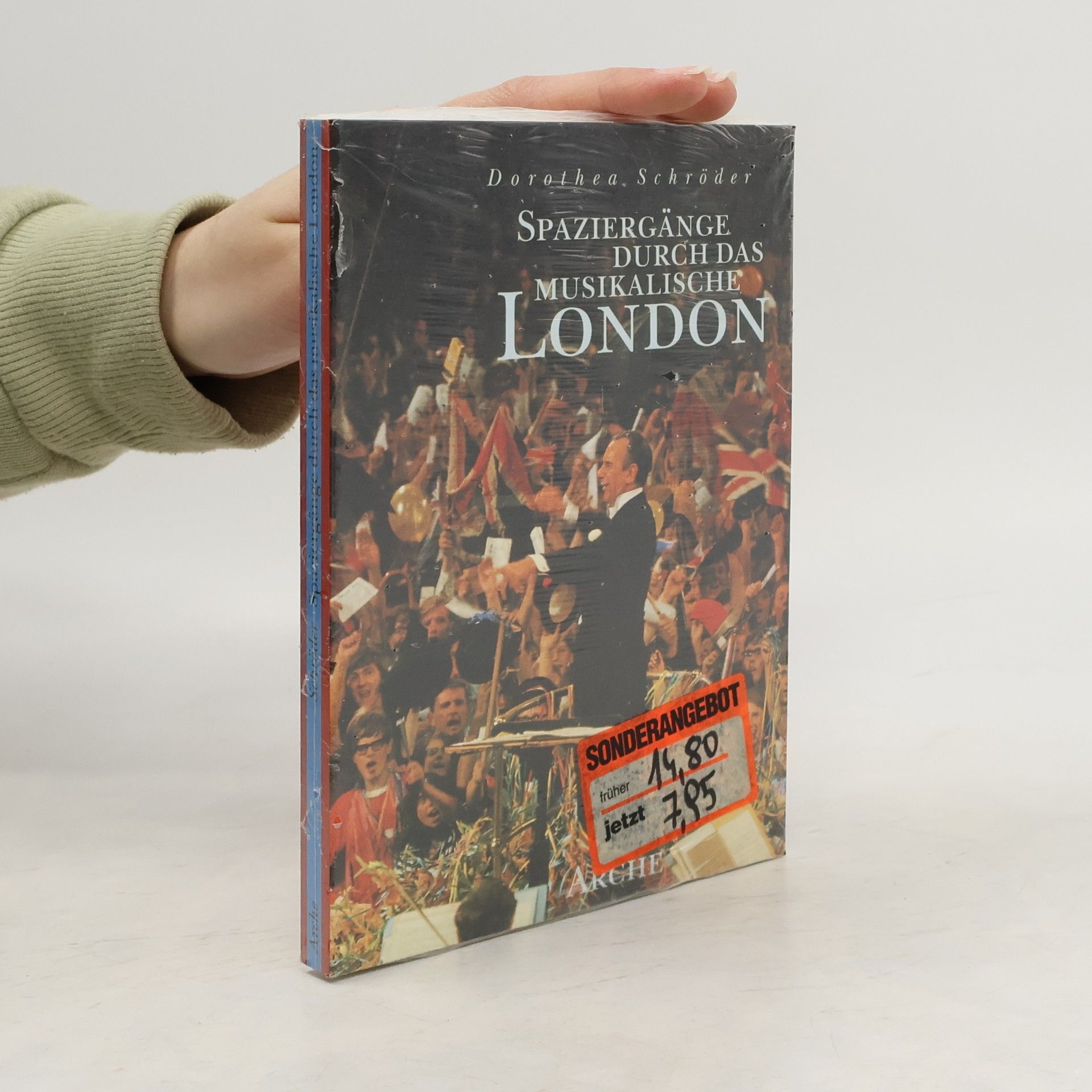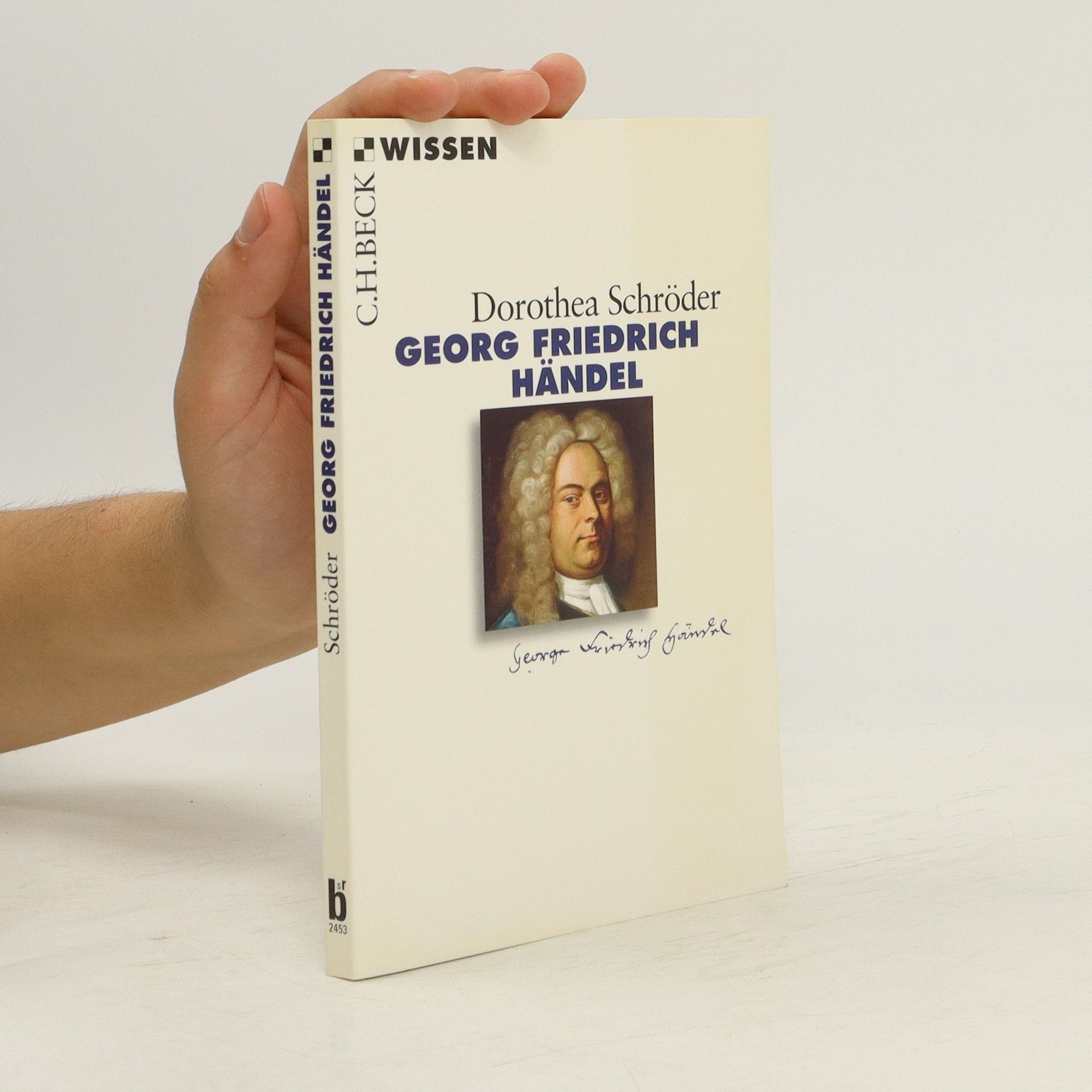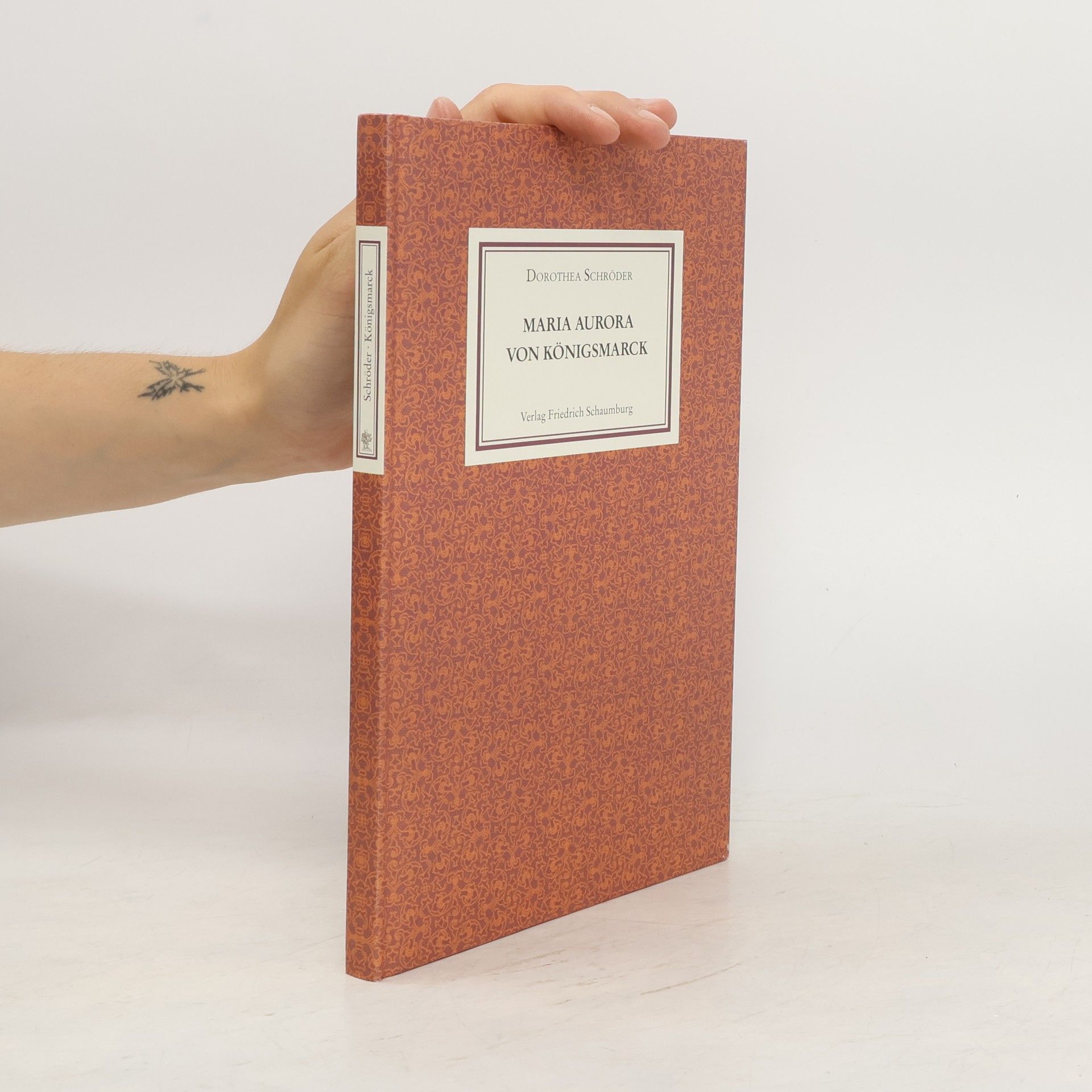Carl Philipp Emanuel Bach
- 112pagine
- 4 ore di lettura
Am 8. März 2014 feiert die Musikwelt den 300. Geburtstag von Carl Philipp Emanuel Bach, dem zweitältesten Sohn Johann Sebastian Bachs, der zu Lebzeiten berühmter war als sein Vater. Als Hauptvertreter des ausdrucksvollen „empfindsamen Stils“ prägte er die Übergangsepoche zwischen Spätbarock und Wiener Klassik: Haydn, Mozart und Beethoven kannten und schätzten seine Kompositionen. Nach drei Jahrzehnten im Dienst Friedrichs II. von Preußen zog Bach 1768 nach Hamburg, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 1788 als Musikdirektor der Haupt - kirchen und Konzertveranstalter tätig war. Sein vielfältiges OEuvre umfasst neben der Klaviermusik, die seinen Ruhm begründete, auch Sinfonien, Instrumental - konzerte, Kammermusik, Oratorien, Kantaten und Lieder. In allen Genres fasziniert Bachs höchst individuelle Tonsprache. Ob dramatisch aufrüttelnd oder träumerisch singend, stets folgt die Musik seinem Motto: „Aus der Seele muß man spielen, und nicht wie ein abgerichteter Vogel.“