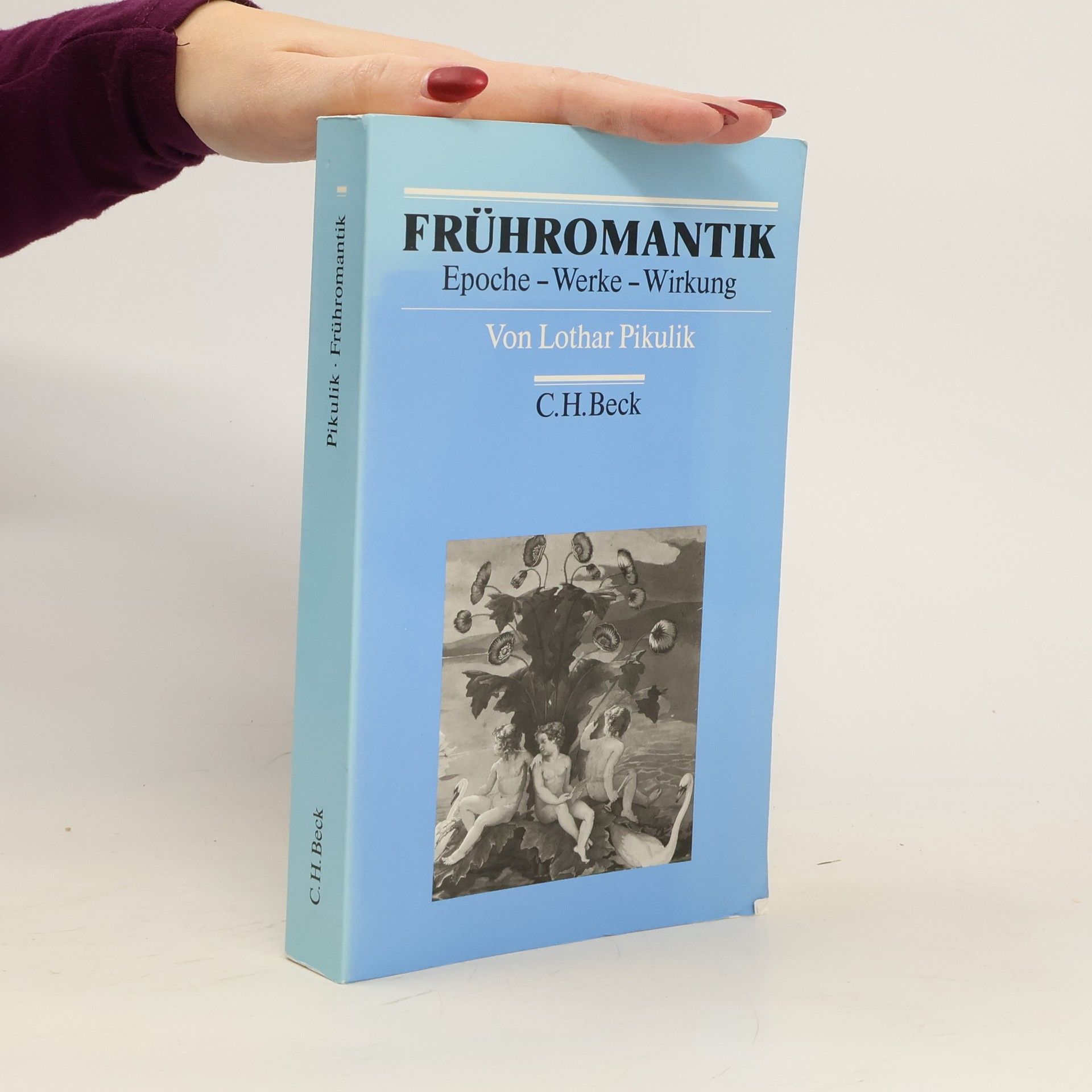Kultur der Neuzeit als Begriff und Problem
Wie kulturelles Denken entsteht und wieder zu verschwinden droht
Die Geschichte der Kultur ist ein Vorgang, der erst in der Aufklärung zu sich selbst kommt. Denn erst damals gelangt zum Bewusstsein, dass „Kultur“ den deutlichen Unterschied gegenüber „Natur“ markiert und in dieser Hinsicht die Begründung einer zur „Würde“ animierten Menschlichkeit bedeutet. Auch wenn der Begriff Kultur sich zunächst festigt und besonders im deutschsprachigen Bereich von dem ähnlich gearteten Begriff Zivilisation abgrenzt, widerfährt ihm in der neuesten Zeit ein grundlegender Wandel, der seine Geltung beeinträchtigt: Zum einen durch die autoritär wirkende digitale Computerideologie, zum anderen durch die den menschlichen Willen ebenfalls beeinträchtigende Pandemie. Beides stellt den Menschen vor die Frage, ob und wie er kulturell weiterexistieren kann.