Der Band untersucht die Reiseliteratur um 1800 und beleuchtet die Vielfalt ihrer Formen, die von gelehrten Reiseberichten bis zu Reiseromanen reichen. Diese unterschiedlichen Ausdrucksformen reflektieren die variierenden Reiseintentionen und -ziele der Autoren sowie die spezifischen Bedürfnisse der Leser zu Beginn der literarischen Moderne. Die Analyse zeigt, wie die Reiseliteratur auf gesellschaftliche Veränderungen reagierte und neue Perspektiven auf das Reisen eröffnete.
Uwe Hentschel Libri
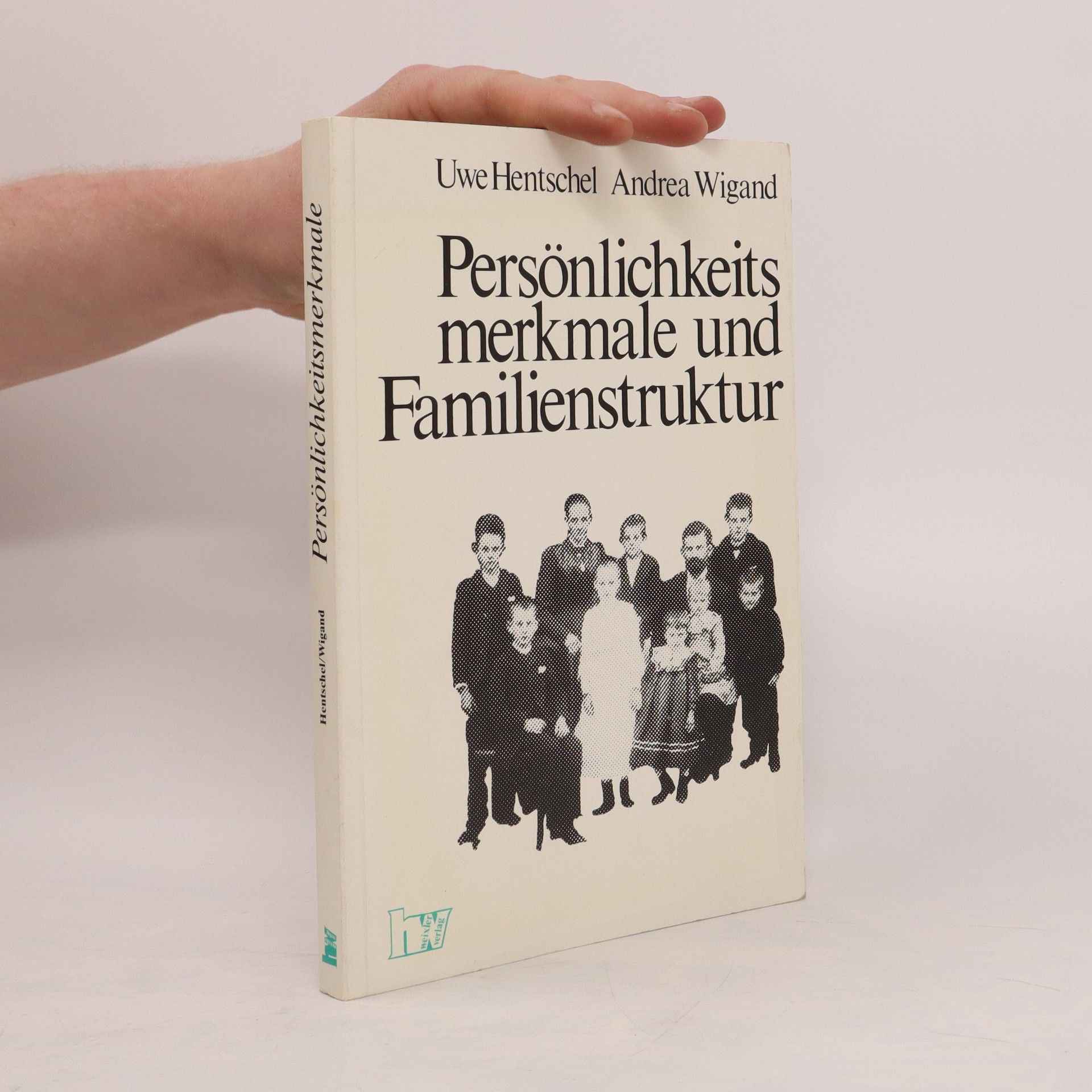




Die Lausitz in alten Reisebeschreibungen des 18. und 19. Jahrhunderts
- 440pagine
- 16 ore di lettura
Die Reisebeschreibungen von über 20 Autoren bieten einen faszinierenden Einblick in die Lausitz um 1800, als Reisende die malerische Landschaft und ihre einzigartigen Menschen, die Wenden/Sorben, entdeckten. Diese Berichte helfen, Vorurteile abzubauen und vermitteln ein authentisches Bild einer Region, die durch ihre Sprache und Kultur geprägt ist. Die Autoren laden die Leser ein, eine Welt zu erkunden, die trotz ihrer historischen Wurzeln bis heute relevant bleibt, und zeigen, wie die Begegnungen mit den Einheimischen das Verständnis für diese deutsche Heimat vertiefen.
Der Nordosten Deutschlands wurden vergleichsweise spät, erst um 1800, von einer größeren Zahl Reisender besucht. Zu groß waren die Vorbehalte, zu schlecht die Verkehrswege. Erst mit der Gründung des ersten deutschen Seebades 1794 in Heiligendamm wuchs das Interesse für Mecklenburg und die Ostsee; Lust- und Bildungs-Reisende kamen, fuhren durchs Land, besuchten die Städte. Wie durch ein Fenster lassen uns die reisenden Autoren in eine Welt schauen, die, bereits 200 Jahre alt, zu unserer Vergangenheit zählt und doch auch Teil unserer Gegenwart ist. Ein aufschlussreicher, unterhaltsamer Band, mit zahlreichen historischen Abbildungen. Reisen macht Spaß und bildet. Besonders stressfrei und nachhaltig auf der Couch – mit einem guten Buch. Einem wie diesem.
Mythos Schweiz
Zum deutschen literarischen Philhelvetismus zwischen 1700 und 1850
Unter Heranziehung von mehr als 500 literarischen und publizistischen Texten wird erstmals nach 1945 dem Phänomen der Schweizbegeisterung der Deutschen über einen Zeitraum von 150 Jahren nachgegangen. Nach der Beschäftigung mit den sozial- und geistesgeschichtlichen Voraussetzungen, die die emphatische Zuwendung zum Nachbarland erst ermöglichten, werden die Konstituenten des sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts etablierenden Mythos herausgearbeitet. Die Eidgenossenschaft wurde von vielen Deutschen zu einem Refugium stilisiert, das sich der dekadenten höfischen und der modernen bürgerlichen Lebenswelt entgegenstellen ließ und somit als Spiegelungsraum eigener Wünsche und Hoffnungen dienen konnte. Es entstand eine Begriffs- und vor allem Bildwelt, die innerhalb des Untersuchungszeitraums weitestgehend konstant blieben, auch wenn Teile der publizierenden Öffentlichkeit kontroverse Debatten über die politischen Strukturen des Nachbarlandes führten und zeitweise sogar - insbesondere während der Befreiungskriege - zu einer kritischen Sicht auf die Schweiz gelangten.