Das Periodikum IMAGO wurde mit dem Ziel gegründet, Diskussionen zwischen Kunst, Ästhetik, Psychoanalyse und angrenzenden Disziplinen anzustoßen und zu intensivieren. Das Jahrbuch versammelt interdisziplinär orientierte Beiträge, die sowohl grundsätzliche theoretische Fragen behandeln als auch Deutungen empirischen Materials liefern.Das weitgefächerte Themenspektrum des dritten Bandes reicht von Gewalt und Gelächter in der Literatur des Mittelalters über die Ozeanische Entgrenzung in den Künsten und das Verhältnis von Kunst und Lebenswelt bis zu Fantasie und Wahrnehmung im Spiegel neuer Kino-Technologien.Mit Beiträgen von Barbara Borg, Martin Büchsel, Manfred Clemenz, Markus Dauss, Martin Gessmann, Carola Hilmes, Sebastian Leikert, Marc Ries, Werner Röcke, Kerstin Thomas, Christiane Voss und Hans Zitko
Manfred Clemenz Libri
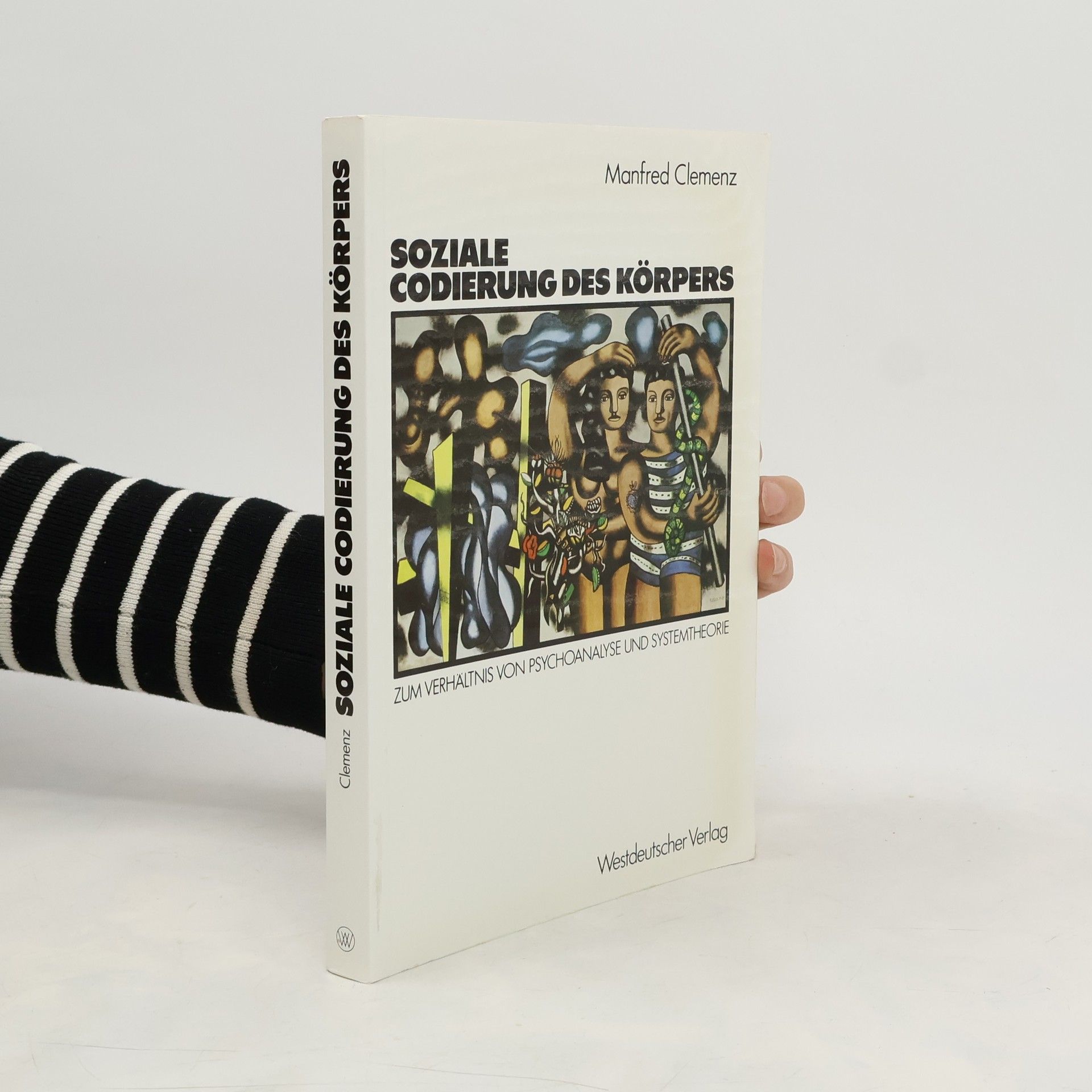




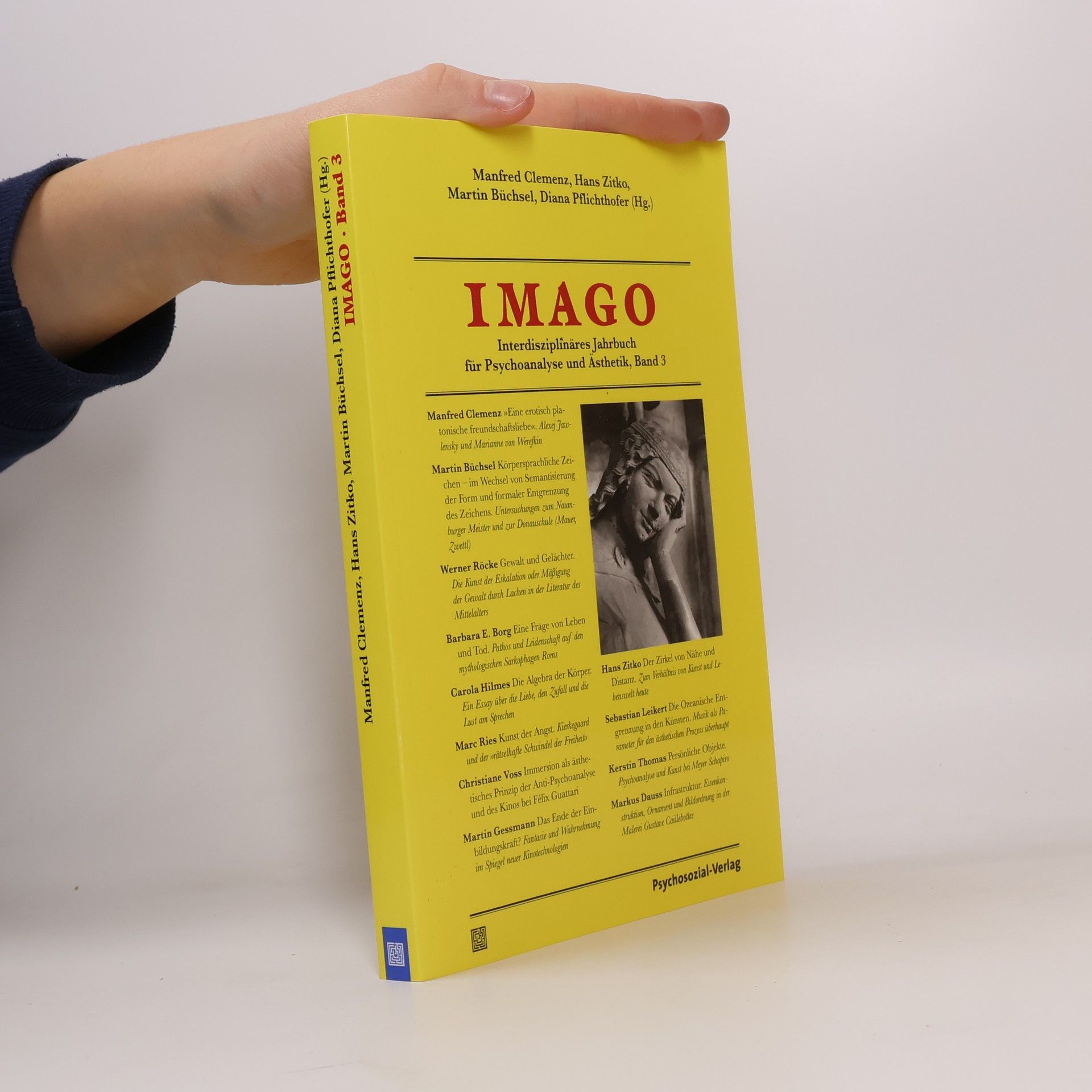
Diese Arbeit versucht - unter andem durch den Strukturvergleich vorfaschistischer Gesellschaftssysteme - nachzuweisen, daß die Entstehung faschistischer Systeme primär auf drei Faktoren zurückzuführen ist: auf die politisch-soziale Sonderentwicklung einer Reihe kapitalistischer Gesellschaften, deren typischer Ausdruck das Scheitern der bürgerlichen Revolution ist, auf eine ebenfalls gescheiterte proletarisch-kleinbürgerliche Revolution und auf eine umfassende Krise des kapitalistischen Systems. Gleichzeitig wird versucht, aus dieser Analyse Hinweise auf Bedingungen und Möglichkeiten faschistischer Entwicklungen in der Phase des monopolistischen Kapitalismus abzuleiten. Theoretisches Resultat der Arbeit ist die Formulierung eines - vorläufigen - kategorialen Rahmens einer kritisch-materialistischen Theorie über die Entstehung des Faschismus.
Van Gogh: Manie und Melancholie
Ein Porträt
Trotz der strahlenden Farben und Formen sieht van Gogh Kunst als Mühsal und Leiden. Sie ist für ihn sowohl Krankheit als auch Therapie. Sein kreativer Schaffensrausch wechselt mit tiefer Melancholie, wobei er Leiden als Voraussetzung für Kreativität betrachtet. Der Band untersucht van Goghs Leben, Werk und Kunstphilosophie aus psychologischer Sicht.
Sigmund Freuds 'Gründungsdokument' der psychoanalytischen Interpretation bildender Kunst wird hier kritisch gegengelesen. Clemenz zeigt in seiner Würdigung des Freudschen Essays, dass Freud versucht hat, eine exemplarische Fallgeschichte vorzulegen, die den Anspruch erhob, Biografie nicht nur retrospektiv zu verstehen, sondern auch prospektiv zu erklären. Manfred Clemenz führt die tieferen Gründe aus, warum Freuds Vorhaben scheitern musste, die Person Leonardo da Vinci zu verstehen und ihr gerecht zu werden. Gleichzeitig gibt er einen Ausblick und liefert Kriterien für eine adäquate psychoanalytische Kunstinterpretation.
Der Mythos Paul Klee
Eine biographische und kulturgeschichtliche Studie
Bereits 1920 stilisierte sich Paul Klee (1879–1940) zum weltentrückten Künstler und Metaphysiker, ein Mythos, den seine Biographen aufgriffen und über Jahrzehnte verbreiteten. In seinem Buch geht Manfred Clemenz der Entstehung und Geschichte dieses Mythos erstmals auf den Grund. Er rekonstruiert den biographischen, zeitgeschichtlichen und kunstphilosophischen Hintergrund des Schaffens von Paul Klee und skizziert so ein realistisches Portrait des Künstlers, das signifikant von den harmonisierenden Darstellungen der bisherigen Klee-Biographik abweicht. Selbstzweifel, Depressionen, der Kampf zwischen Geist und Trieb sowie eine körperfeindlich-asketische Haltung prägen dieses Bild. Als Grundlage der Rekonstruktion dienten dem Autor neben autobiographischen und kunsttheoretischen Schriften Klees auch eine Reihe bisher unveröffentlichter Texte wie die Lebenserinnerungen seiner Frau Lily und die Tagebücher Petra Petitpierres, seiner langjährigen Freundin und Vertrauten.
Die soziale Codierung des Körpers und die Einheit von Körper und Sozialität stehen im Mittelpunkt dieser Analyse. Der erste Teil behandelt die Triebdynamik und Interaktionsstruktur, insbesondere in der Psychoanalyse, und illustriert dies am Beispiel der Fallgeschichte eines fünfjährigen Jungen mit Phobie. Es werden zentrale Probleme und Fragestellungen erörtert, die Vorgeschichte der Phobie, sowie die Rolle der familialen Beziehungsstruktur und die Pathogenese der Phobie. Ein Exkurs thematisiert die Verbindung zwischen Körper und Symbol. Der zweite Teil widmet sich der Metapsychologie der Psychoanalyse und untersucht „Körper“ und „Sinne“ als grundlegende Kategorien. Hierbei werden die Gegenstandsbestimmung der Psychoanalyse, die Rolle von Körper und Interaktion sowie Freuds Hermeneutik des Körpers behandelt. Der dritte Teil betrachtet die Systemtheorie als therapeutisches Paradigma und diskutiert menschliche Interaktion aus der Perspektive der pragmatischen Kommunikationstheorie. Es wird die Bedeutung der Psychotherapie als Sozialtechnologie sowie die Dynamik familialer Interaktionen analysiert. Der letzte Teil thematisiert die Familie als Interaktionssystem und die Herausforderungen der Verbindung von Familiensoziologie und Familientherapie. Abschließend werden theoretische Rahmenbedingungen familialer Interaktion skizziert und Schlussfolgerungen gezogen.