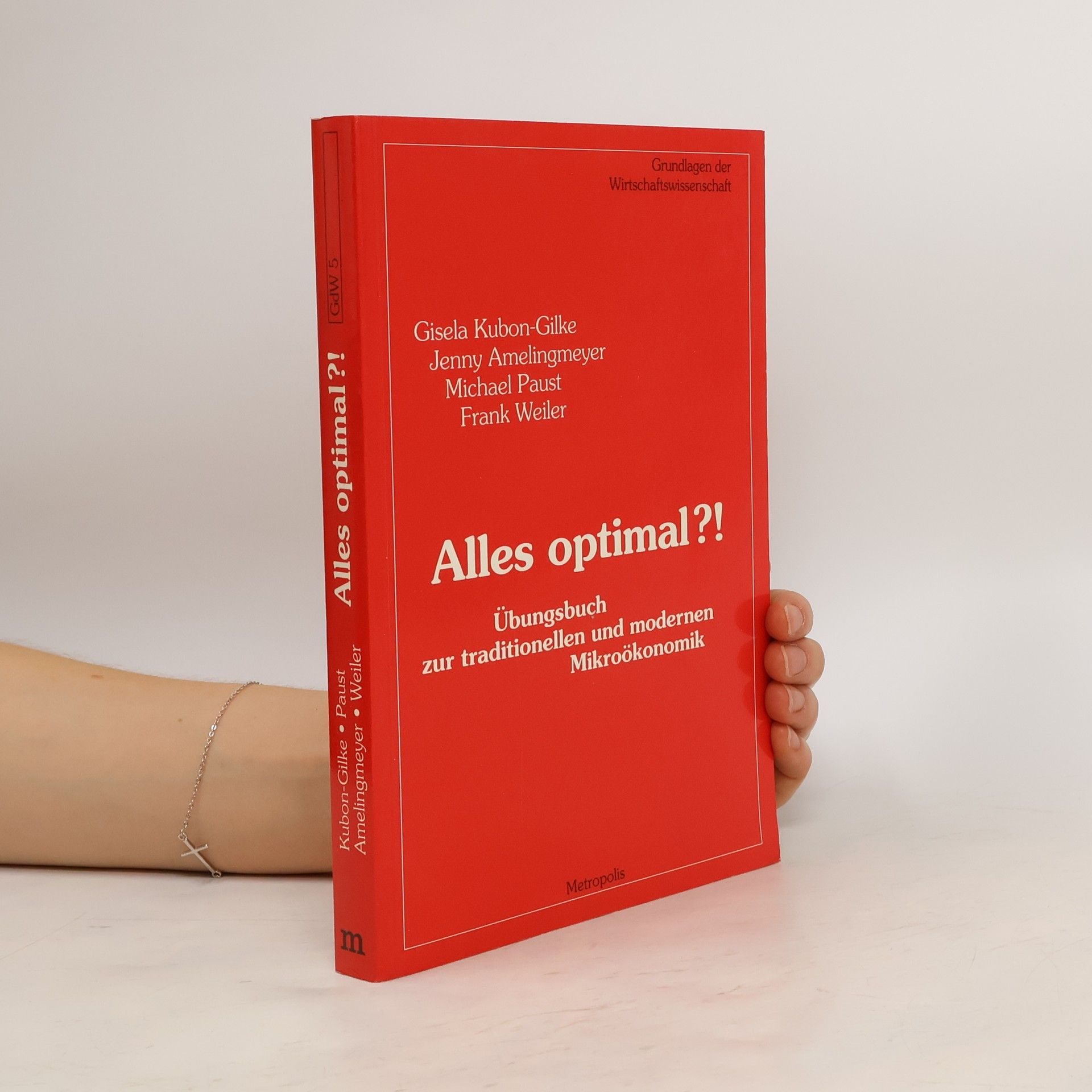Alles optimal?!
Übungsbuch zur traditionellen und modernen Mikroökonomik
Während es eine Reihe ausgezeichneter Lehrbücher zur Mikroökonomie gibt, herrscht ein deutlicher Mangel an guten Übungsbüchern, mit deren Hilfe die Studierenden den gelernten Stoff einüben und vertiefen und sich so beispielsweise auf Prüfungen vorbereiten können. Dieses neue Übungsbuch schließt diese Lücke, indem es den „traditionellen“, aber auch „neueren“ Stoff im Rahmen von Übungsaufgaben aufbereitet. Und weil die Mikroökonomie nicht nur graue Theorie sein muss, sind die Aufgaben in eine fortlaufende Geschichte eingebettet, wodurch die mikroökonomischen Problemstellungen lebendig und anschaulich werden. Das Buch enthält eine prägnante Einführung in das jeweilige Thema liefert ausführliche und leicht nachvollziehbare Lösungen in mathematischer und graphischer Form legt Wert auf die ökonomische Interpretation mathematischer Ergebnisse ist ideal zum Einüben und Vertiefen des Prüfungsstoffes enthält überwiegend Aufgaben, die durch Studierende getestet und mitgestaltet wurden kann in Verbindung mit jedem Standardlehrbuch genutzt werden Inhalt: 1. Theorie des Haushalts - 2. Theorie der Unternehmung I - 3. Vollständige Konkurrenz - 4. Allgemeines Gleichgewicht - 5. Monopol und Monopson - 6. Oligopol - 7. Heterogenes Oligopol und monopolistische Konkurrenz - 8. Externalitäten - 9. Öffentliche Güter - 10. Asymmetrische Informationen - 11. Effizienzlöhne - 12. Theorie der Unternehmen II