Documents the living and working conditions of Austrian authors and illustrators in exile during the Second World War.
Ursula Seeber Libri

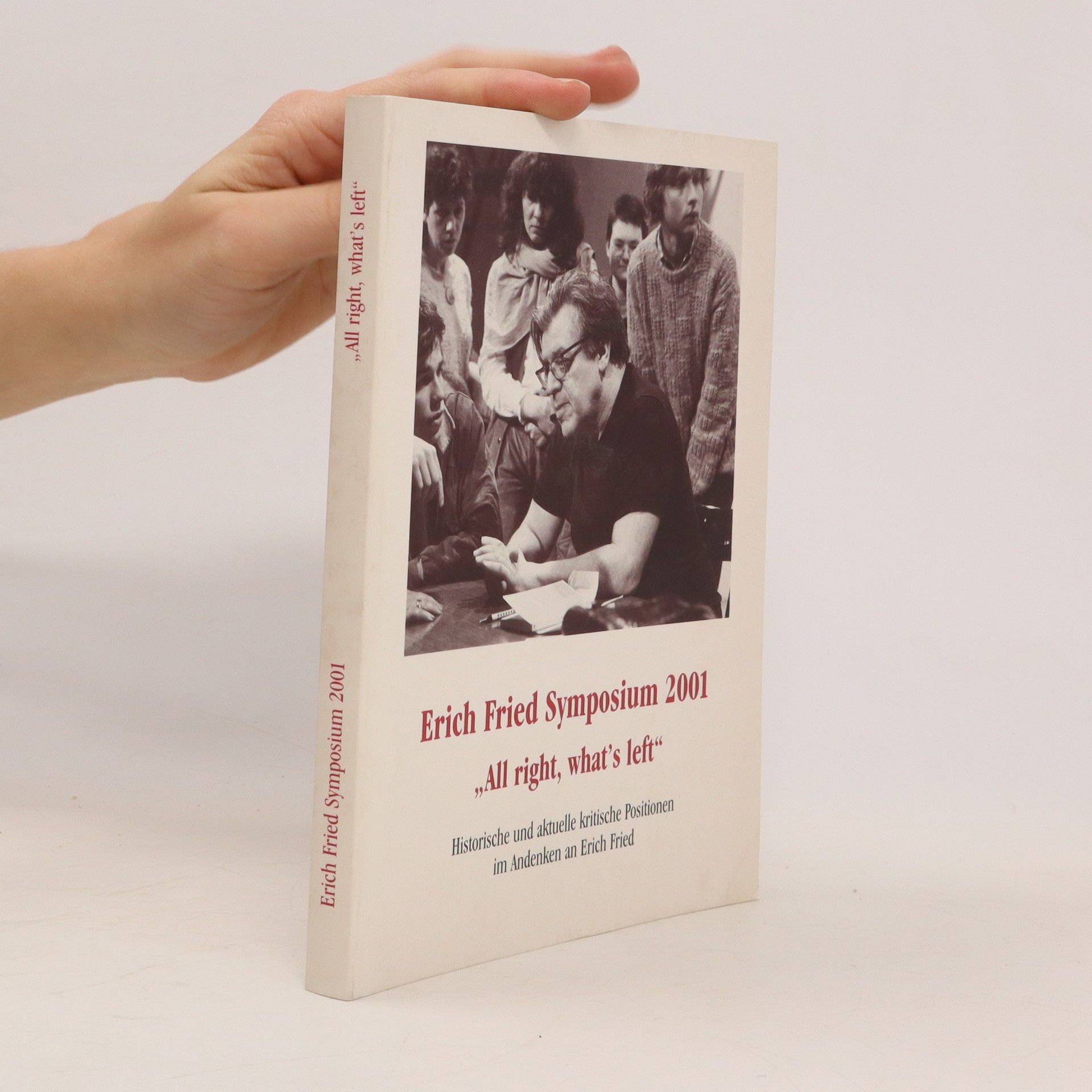

Die Wien-Bilder der 1938 ins Exil Getriebenen sind ambivalent, geprägt von Angst und Sehnsucht, sowie von Phantasie und realer Verstörung. Dieses „andere“ Wien-Buch eröffnet mit Texten des Exils, die eine Heimkehr in die „Traumstadt“ imaginieren, und schließt mit späten Reminiszenzen der jüngeren Generation. Im Mittelpunkt stehen autobiographische Texte, Prosa und Gedichte österreichischer Exilautoren, die von ihrer Rückkehr nach 1945 und den Erfahrungen in Nachkriegs-Wien berichten. Sie betraten die Stadt als „Remigranten“, alliierte Soldaten oder Spurensucher, niemals als Touristen. Ihre Texte thematisieren weniger Aufbruchsoptimismus als Verlust und Entfremdung: der Blick in die arisierte elterliche Wohnung oder die Begegnung mit Wienern – selbstmitleidigen Kellnern und fremdenfeindlichen Bürokraten – verstärken das Gefühl des Exils. Dennoch beschreiben sie auch Momente wiedergewonnenen Heimatgefühls, wenn Sehnsuchtsbilder an der Realität gemessen werden. Die Autorinnen und Autoren, von den Hiergebliebenen zu Außenseitern gemacht, beobachten posthitlerisches Wien mit empathischer Ironie und präziser Optik, wo das Gebliebene gespenstischer wirkt als das Zerstörte. Enthalten sind Texte von zahlreichen bedeutenden Exilautoren.