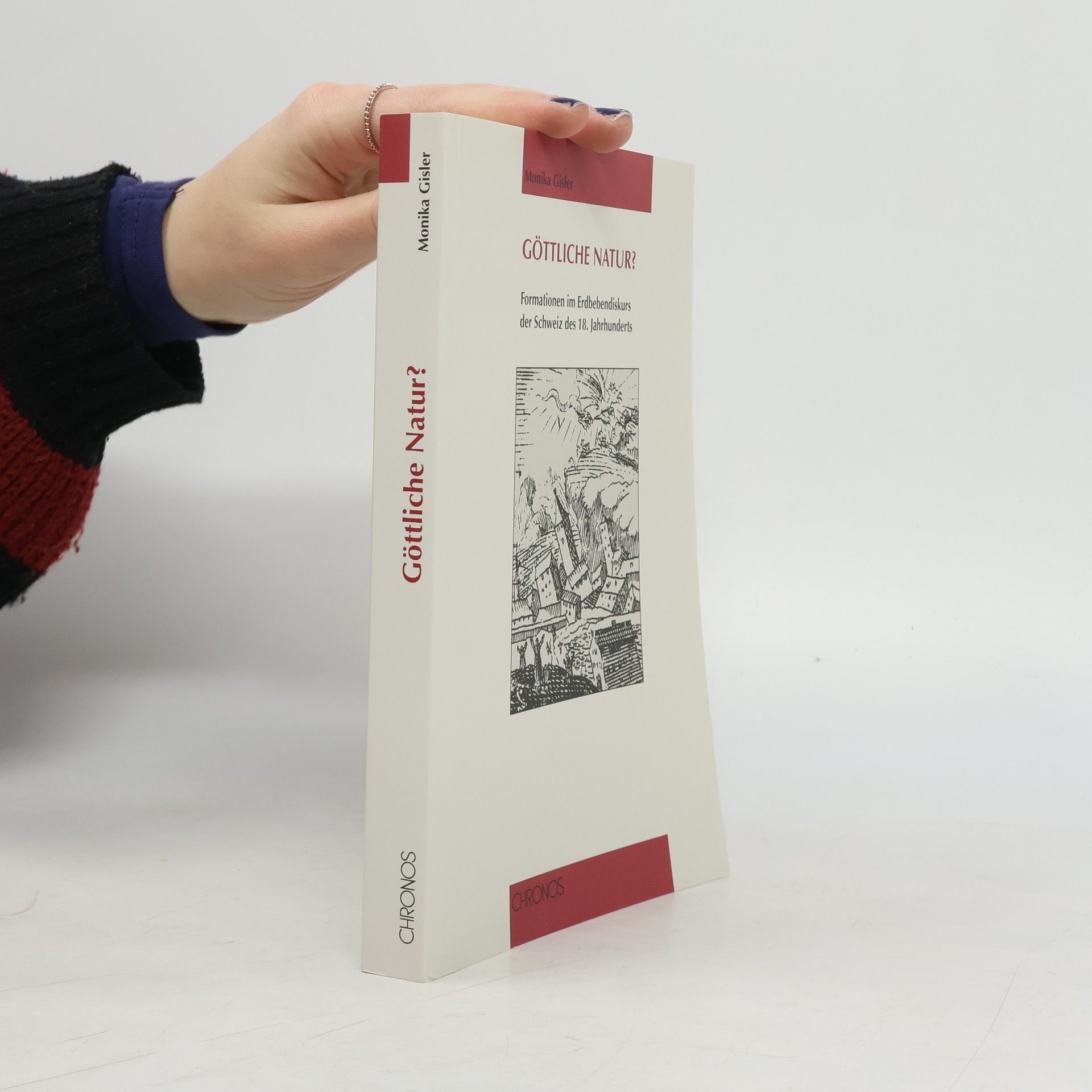Wie die Umwelt an die ETH kam
Eine Sozialgeschichte der Umweltnaturwissenschaften
- 122pagine
- 5 ore di lettura
Als sich Umweltaktivistinnen und -aktivisten in der Schweiz ab 1970 verstärkt Gehör verschafften, konnten sie noch kaum auf wissenschaftliche Erkenntnisse zurückgreifen. Auch Möglichkeiten zur Aus- oder Weiterbildung im Umweltbereich gab es praktisch keine. Einzelne Verwegene hatten zwar damit begonnen, an der ETH Zürich Vorlesungen zu Ökologie und Umwelt anzubieten. Eine Debatte über Wege und Sinn der Umweltforschung und -lehre kam aber erst auf, als sich Studierende, Angehörige des Hochschul-Mittelbaus und die Professorenschaft zu organisieren begannen und die notwendigen Strukturen dafür schufen. Basierend auf dieser Aufbruchstimmung wurde dann in kürzester Zeit ein komplett neuer Studiengang aus der Taufe gehoben: die Umweltnaturwissenschaften. Was aber brauchte es, damit die Umwelt an die ETH kam? Mit dem vorliegenden Buch kann erstmals die Entstehungsgeschichte eines Studiengangs an der ETH Zürich nachverfolgt werden. Die Etablierung der Umweltnaturwissenschaften Mitte der 1980er-Jahre wird aus Sicht der Hochschule und ihrer Protagonisten sowie entlang der politischen und gesellschaftlichen Umbrüche der 1970er- und frühen 1980er-Jahre erzählt.