Werner Seppmann Ordine dei libri
1 gennaio 1950 – 12 maggio 2021
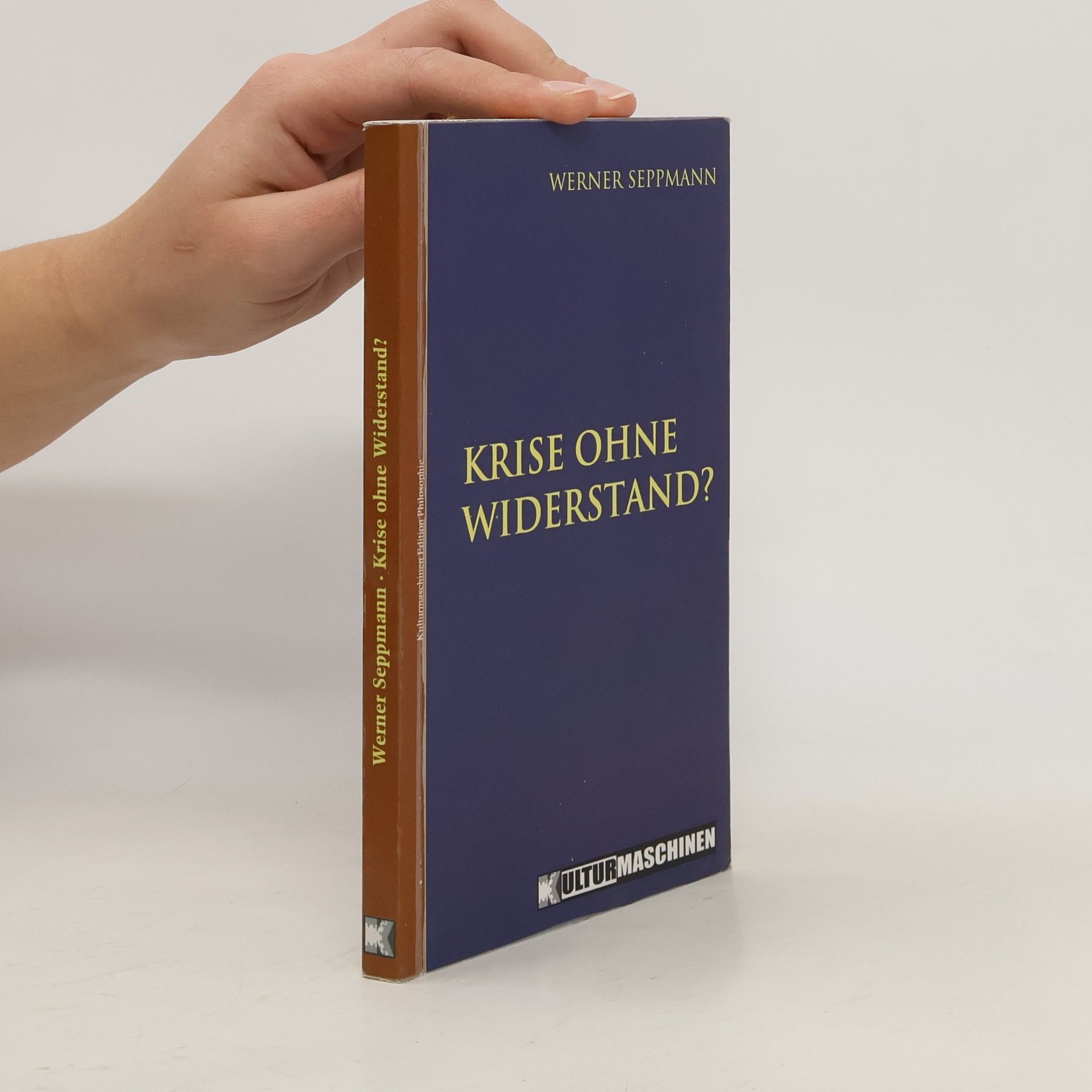

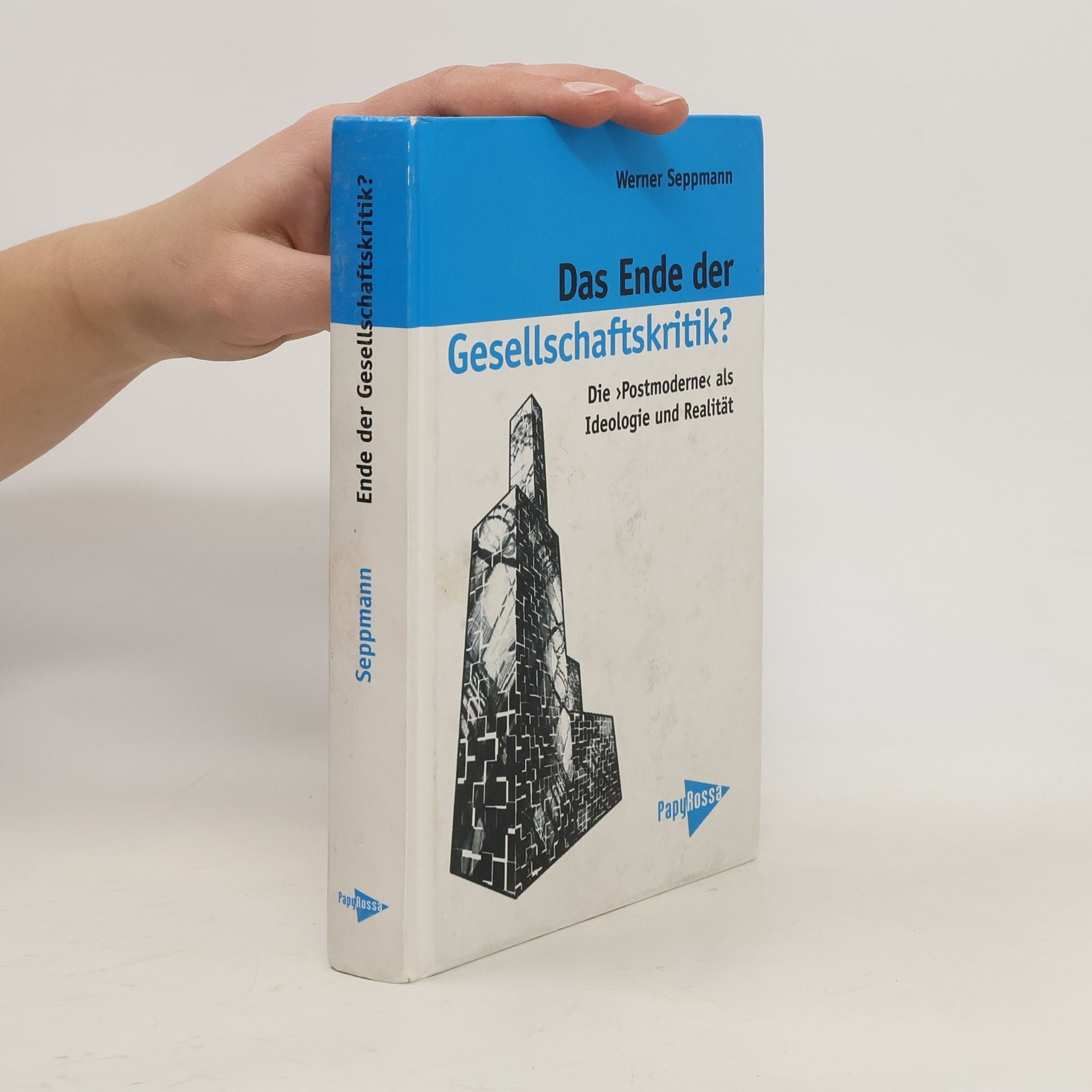
- 2010
- 2000
Love-Parade statt Gesellschaftskritik? Das 'postmoderne Denken' hat seine besten Tage offensichtlich hinter sich. Es thematisiert zwar die soziokulturellen Paradoxien der Gegenwart, nimmt sie aber zugleich als unvermeidlich hin und hält Gesellschaftskritik für nicht mehr zeitgemäß. Trotz eines 'herrschaftskritischen' Gestus wird man polizeiwidrige Aufsässigkeit in diesem Kontext vergeblich suchen. In der gesellschaftstheoretischen Diskussion fördert dies das Bedürfnis nach Aufklärung über den Postmodernismus. Zugleich wächst der intellektuelle Widerstand gegen seinen Monopolanspruch.