Selbstständigkeit gilt als wichtiges Erziehungsziel, doch Schulen, insbesondere die gymnasiale Oberstufe, tun sich schwer, Schüler zu eigenständigem Lernen zu motivieren. Die Vorbereitung auf das Abitur wird oft als Hindernis für selbstständige Lernformen angeführt, obwohl diese für Studium und anspruchsvolle Berufsausbildung unerlässlich sind. Der erste Teil des Bandes beleuchtet die gesellschaftlichen, schul- und unterrichtstheoretischen sowie historischen Grundlagen des selbstständigen Lernens. Im zweiten Teil wird ein Fallbeispiel aus einem Oberstufengymnasium analysiert, das die Herausforderungen und Anforderungen dieser Lernform detailliert betrachtet. Dabei werden Fragen behandelt wie: Welche Probleme haben Schüler beim selbstständigen Erarbeiten von Texten? Welche Chancen und Schwierigkeiten bringt die Gruppenarbeit mit sich? Wie gelingt die selbstständige Steuerung des Lernprozesses? Wann sollte der Lehrer intervenieren? Auf dieser Analyse basierend, bietet der dritte Teil praktische Anregungen für den Unterricht in der gymnasialen Oberstufe, um selbstständiges Lernen zu fördern. Es wird deutlich, dass die Betreuung solcher Lernformen ein Balanceakt zwischen widersprüchlichen Anforderungen darstellt.
Karin Bräu Libri




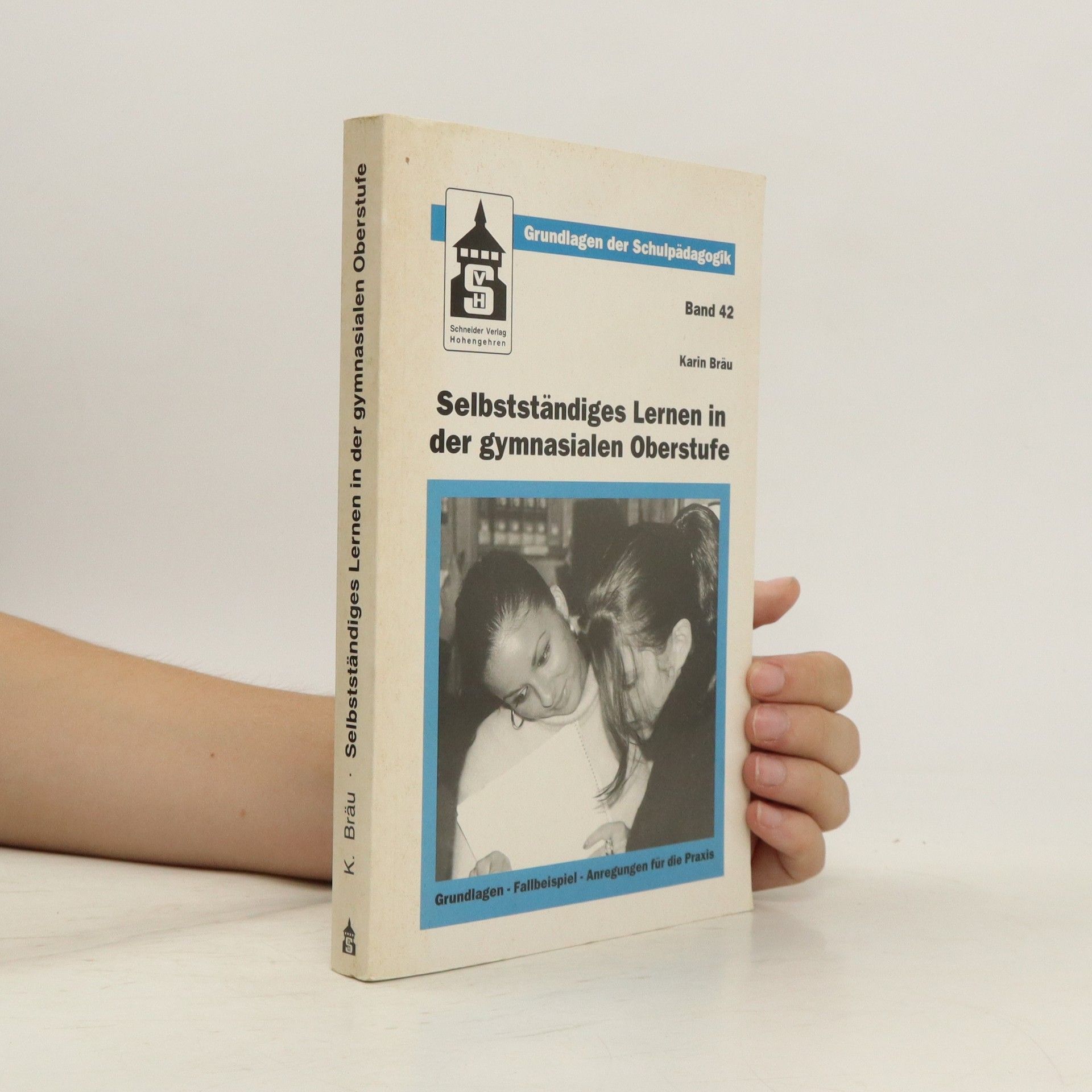
Hausaufgaben
Praxis verstehen, Praxis verändern
Die verborgenen Seiten von Hausaufgaben
- 300pagine
- 11 ore di lettura
Lehrerinnen und Lehrer mit Migrationshintergrund
Zur Relevanz eines Merkmals in Theorie, Empirie und Praxis
Seit nunmehr fast zehn Jahren wird die bildungspolitische Forderung laut, den Anteil an Lehrkräften mit Migrationshintergrund im deutschen Schulsystem zu erhöhen. Dabei werden an den biografischen Hintergrund besondere pädagogische und nicht zuletzt integrationspolitische Erwartungen geknüpft. Die Hypothese, dass Lehrkräfte gleichsam allein durch ihre (familiäre) Migrationserfahrung über besondere interkulturelle Kompetenzen verfügen, ist jedoch bislang weder empirisch belegt noch theoretisch fundiert Mit dieser umfassenden Präsentation aktueller Forschungsergebnisse qualitativer und quantitativer empirischer Studien zu Lehrerbildung und Lehrer-Schüler-Verhältnissen unter migrationsgesellschaftlichen Gegebenheiten möchten die Herausgeberinnen Beiträge leisten, zum einen zum wissenschaftlichen Diskurs um die Relevanz der Kategorie ´Migrationshintergrund´ im Kontext professionellen Lehrerhandelns und zum anderen zur bildungspolitischen Debatte und zur konzeptionellen Weiterentwicklung der Lehrerbildung unter Migrationsbedingungen. Damit richtet sich der Band sowohl an wissenschaftlich interessierte Praktikerinnen und Praktiker, an bildungspolitische Akteure als auch an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie an die in der Lehrerausbildung Tätigen.