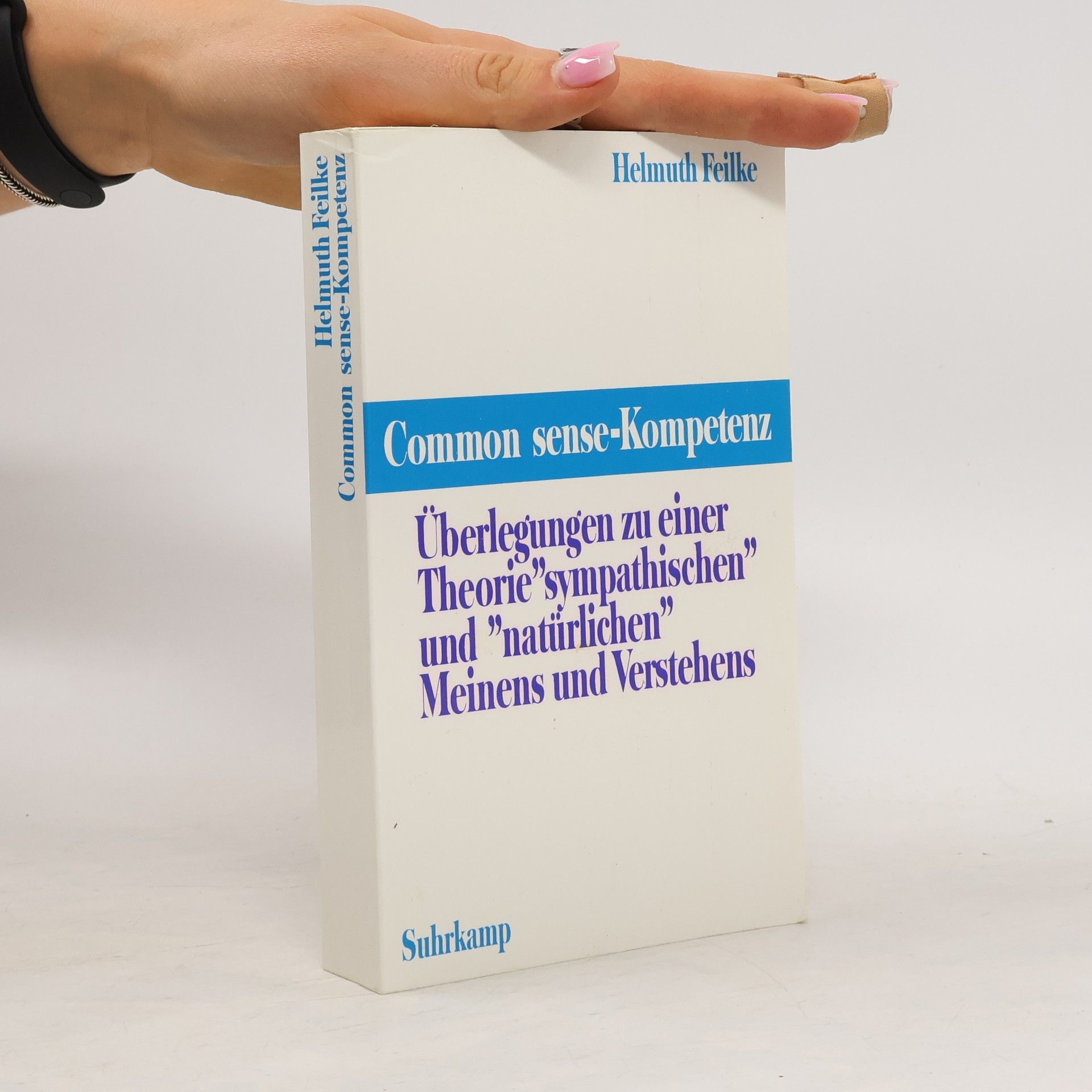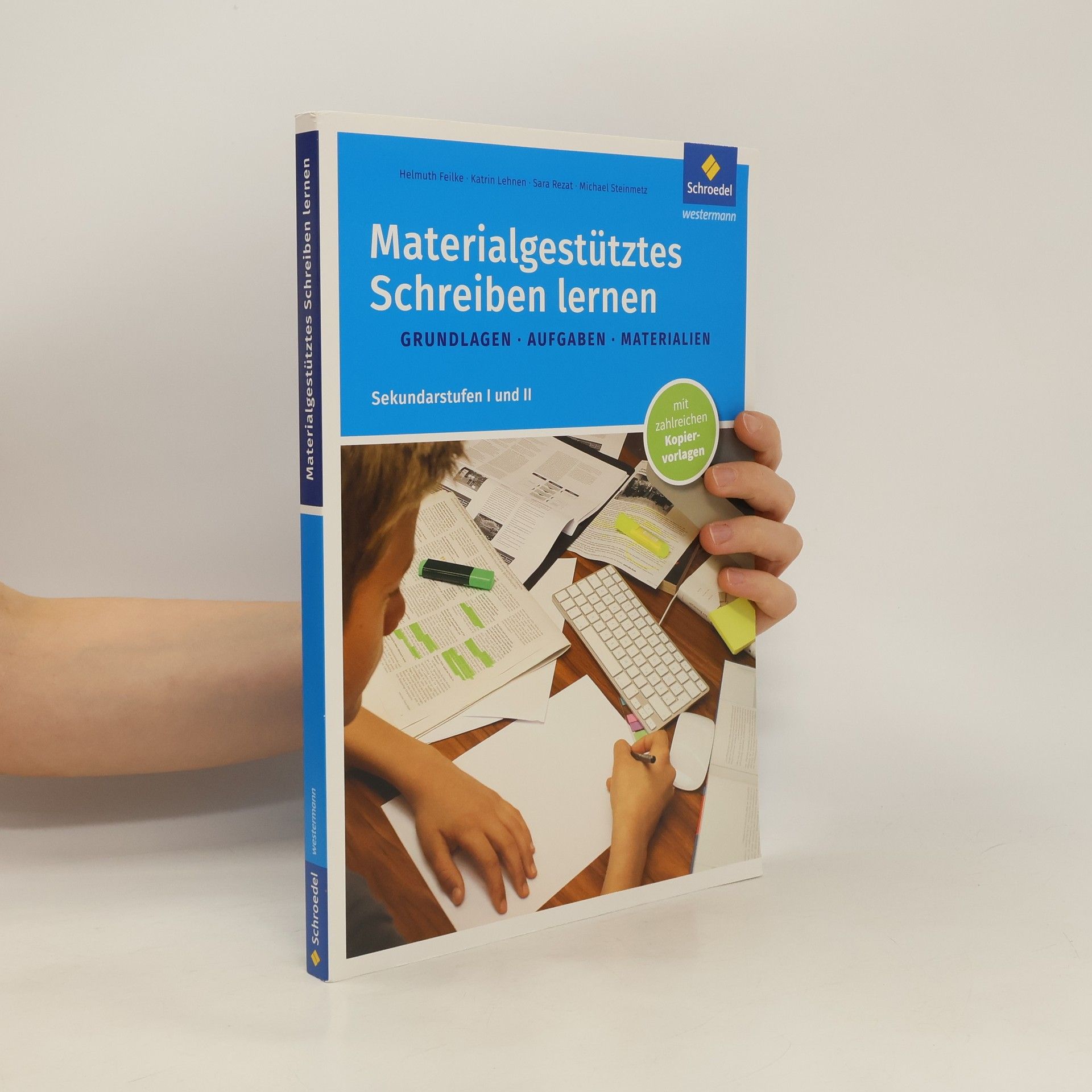Materialgestütztes Schreiben lernen
Grundlagen - Aufgaben - Materialien Sekundarstufen I und II
Das Handbuch für Lehrerinnen und Lehrer führt in die Idee materialgestützten Schreibens ein und verortet diesen neuartigen Aufgabentyp innerhalb der Kompetenzbereiche des Deutschunterrichts. Im Anschluss daran werden schreibdidaktische Aspekte sowie die Konstruktion und Bewertung materialgestützter Schreibaufgaben ausführlich dargestellt. Den zweiten, umfangreicheren Teil des Handbuchs nehmen Aufgabenbeispiele für alle Klassen der Sekundarstufen I und II ein – mit detaillierten Hinweisen zum Unterrichtseinsatz sowie allen benötigten Materialien als Kopiervorlagen .