Zivilisation und Krieg sind untrennbar miteinander verbunden, was besonders aufschlussreich ist, da Hinweise auf tödliche Gewalt gegen Gruppen erst seit dem 6. Jahrtausend v. Chr. in Europa auftauchen. Die erste speziell für den Krieg entwickelte Waffe, das Schwert, setzte sich sogar erst im zweiten Jahrtausend v. Chr. durch. Die Frage bleibt, was die Dynamik des Krieges entfacht hat und warum sie die Geschichte der Menschheit bis heute prägt. Armin Eich bietet in seinem Buch eine faszinierende Analyse der Frühzeit des Krieges. Er beleuchtet die Forschungsergebnisse der Prähistoriker und beschreibt die Auswirkungen verbesserter Waffentechnologien und Strategien in der Bronzezeit, während er auch untergehende Hochkulturen wie die Mykenische und die Hethitische betrachtet. In weiteren Kapiteln untersucht er die besorgniserregenden Zusammenhänge zwischen Rohstoffhandel, aufkommender Staatlichkeit und der Monetarisierung von Kriegen in klassischer Zeit. Den Abschluss bildet eine Analyse der traumatisierenden Zustände eines entgrenzten Kriegs, in dem die ständige Konfrontation mit Kriegserlebnissen die psychische Struktur der Betroffenen verändert und organisierte Gewalt zu einem unvermeidlichen Schicksal in der Antike wird.
Armin Eich Libri


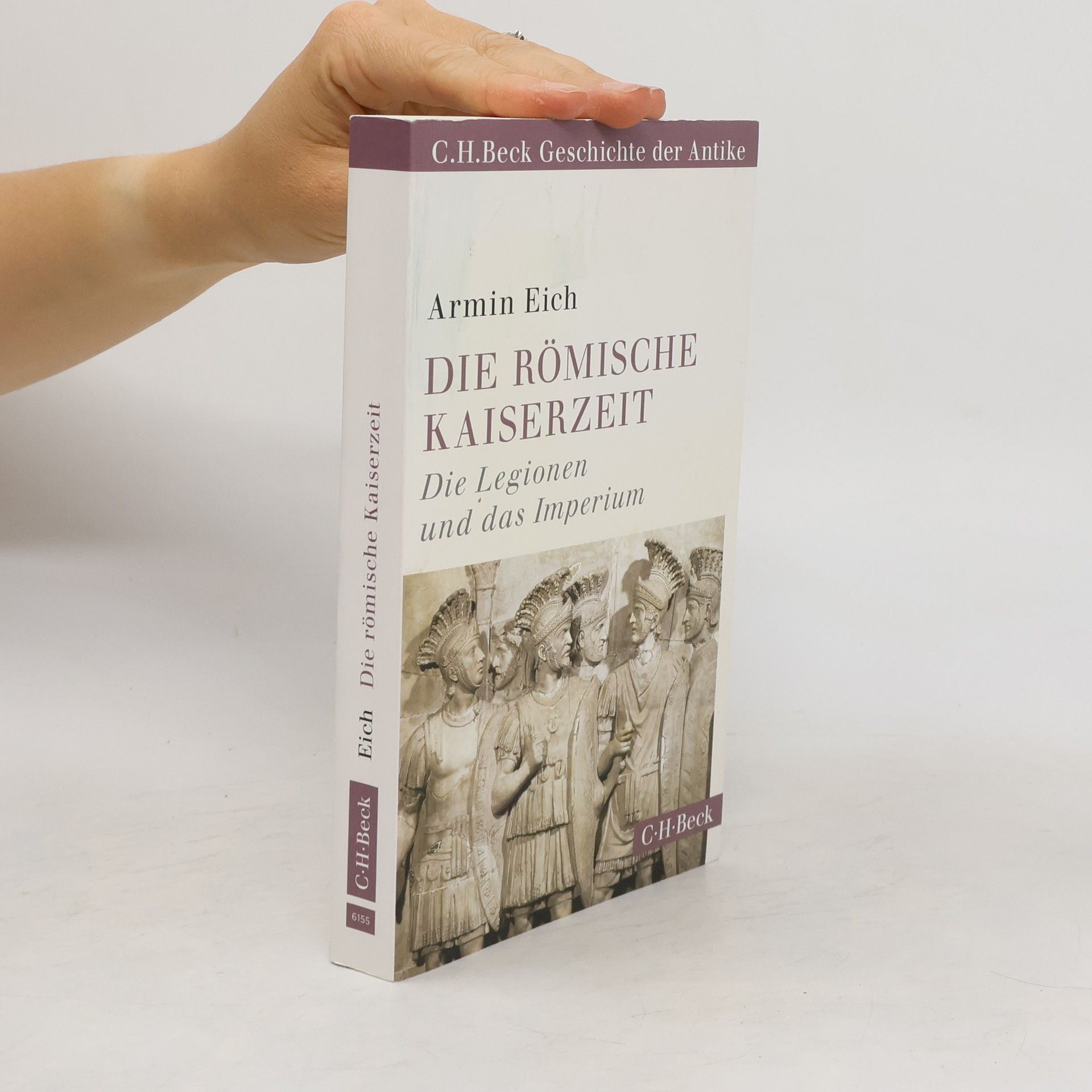
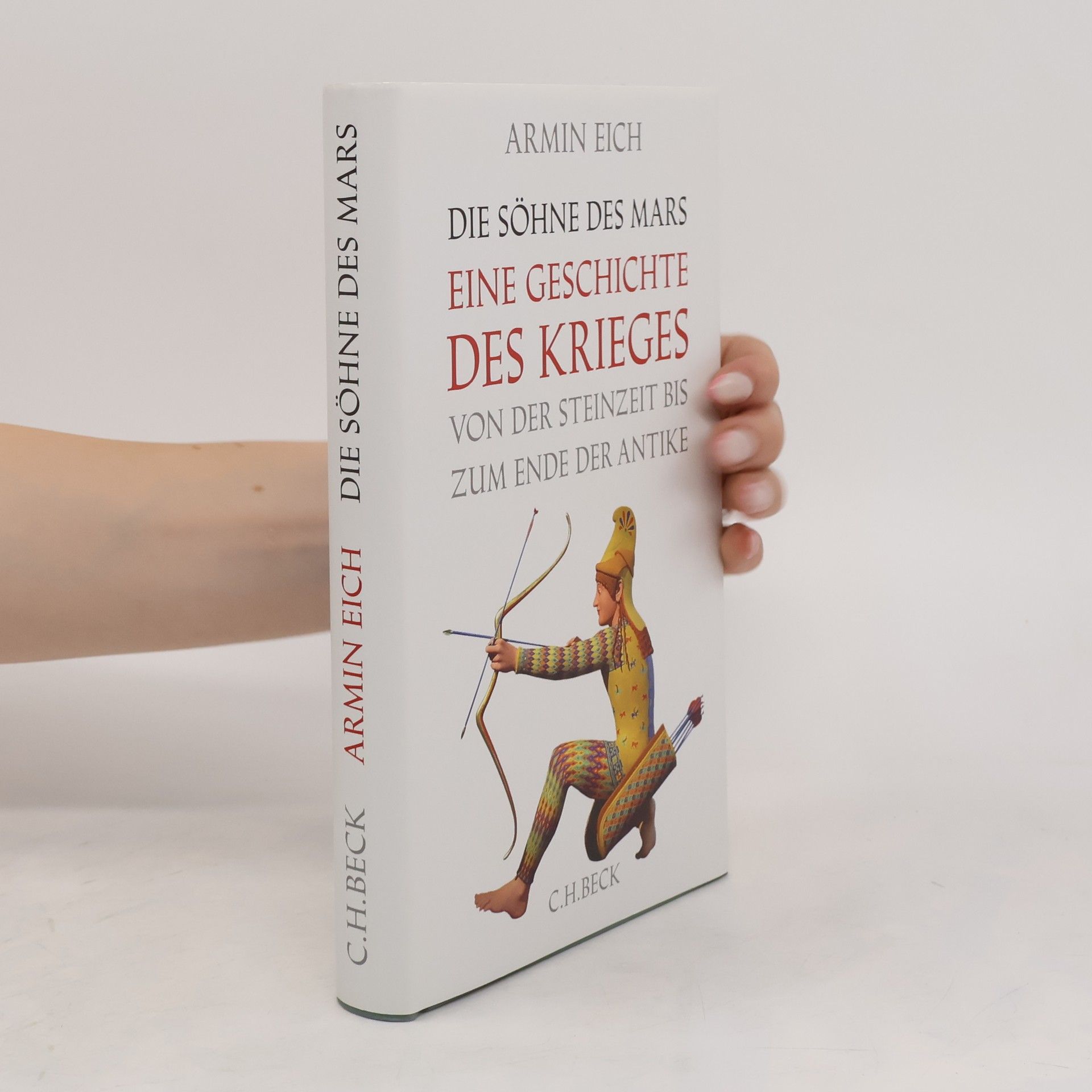
Die römische Kaiserzeit
- 304pagine
- 11 ore di lettura
Die besondere Stellung des neuen Herrn im römischen Staat, den der Senat mit dem Ehrennamen Augustus ausgezeichnet hatte, beruhte auf Ausnahmegewalten. Sie waren ihm im Jahr 27 v. Chr. höchstpersönlich zuerkannt worden und hätten eigentlich nach zehn Jahren erlöschen sollen. Tatsächlich wurden diese Sondervollmachten immer wieder verlängert und blieben bis an sein Lebensende in Kraft. Augustus nutzte sie, um ein schlagkräftiges Berufsheer aufzubauen, das auf ihn als seinen Oberbefehlshaber eingeschworen war. Diese professionelle Armee, die Augustus als sein persönliches Machtinstrument konzipiert hatte, entwickelte nach dem Tod ihres Schöpfers politisches Eigengewicht und bestimmte fortan maßgeblich die Geschicke des Imperiums. In letzter Instanz bestimmten die Soldaten, wer über das Reich als Imperator herrschen sollte. Der römische Staat wurde zu einem vom Militär dominierten Kaiserreich.
Wilhelm Dörpfeld (1853–1940) war eine prägende Figur der modernen Archäologie, die in ihm vereinte Eigenschaften aufweist, die selten in einer Person zu finden sind. Er war ein präzise denkender Wissenschaftler, der gleichzeitig von der Leidenschaft getrieben wurde, den archäologischen Quellen Geheimnisse zu entlocken, die oft im nüchternen Forschen verborgen bleiben. 1912 gab er seine Direktorposition beim Deutschen Archäologischen Institut in Athen auf, um ungehindert seinen Forschungen zur Heimat des Odysseus nachzugehen. Trotz zahlreicher inhaltlicher und persönlicher Angriffe verteidigte er seine Thesen mit Entschlossenheit. Archivmaterialien im Wuppertaler Stadtarchiv sowie an verschiedenen Orten seiner Tätigkeit, darunter Leiden, Berlin, Athen und Kairo, dokumentieren die wissenschaftlichen Kämpfe, die Dörpfeld bis zu seinem Lebensende führte. Im Juli 2018 trafen sich Wissenschaftler an der Bergischen Universität Wuppertal, um ihr Wissen über dieses Archivmaterial auszutauschen. Dabei wurde auch Dörpfelds Engagement in den politischen Auseinandersetzungen seiner Zeit, einschließlich seiner Position gegenüber dem Nationalsozialismus, eingehend behandelt. Die Ergebnisse dieser Forschungen werden in diesem Band präsentiert.
Die Verurteilung des Krieges in der antiken Literatur
- 275pagine
- 10 ore di lettura