Künstliche Intelligenz („KI“) durchdringt bereits alle Lebensbereiche, von Kreditentscheidungen bis hin zu Kaufempfehlungen. Dank Deep Learning übertreffen Maschinen in vielen hochqualifizierten Berufen die menschliche Leistung. Banken und die Politik nutzen KI ebenfalls, während namhafte Wissenschaftler vor den potenziellen Gefahren warnen. Stephen Hawking äußerte Bedenken, dass KI die Menschheit ersetzen könnte, wenn sie sich selbst verbessert und vermehrt. Trotz dieser Warnungen steigen die Investitionen in KI, da der Return on Invest (ROI) vielversprechend ist. Besonders in Silicon Valley fließen Milliarden in die Forschung. Oft konzentrieren sich Diskussionen über KI auf philosophische oder technische Aspekte, während juristische Fragen vernachlässigt werden. Der Autor nimmt den Leser mit auf eine rechtliche Erkundung der KI. Er beleuchtet grundlegende Fragen zur Definition von KI aus juristischer Sicht und erörtert Themen wie die Lizenzierung von Algorithmen, den Schutz von Deep Learning-Ergebnissen sowie Haftungs- und Datenschutzfragen. Zudem wird untersucht, was ein Cyborg ist und welche rechtlichen Implikationen damit verbunden sind. Der Einfluss von KI auf die Arbeitswelt und die rechtlichen Herausforderungen des autonomen Fahrens werden ebenfalls behandelt. Der Autor beantwortet zahlreiche relevante Fragen zu diesen Themen.
Thomas Söbbing Libri
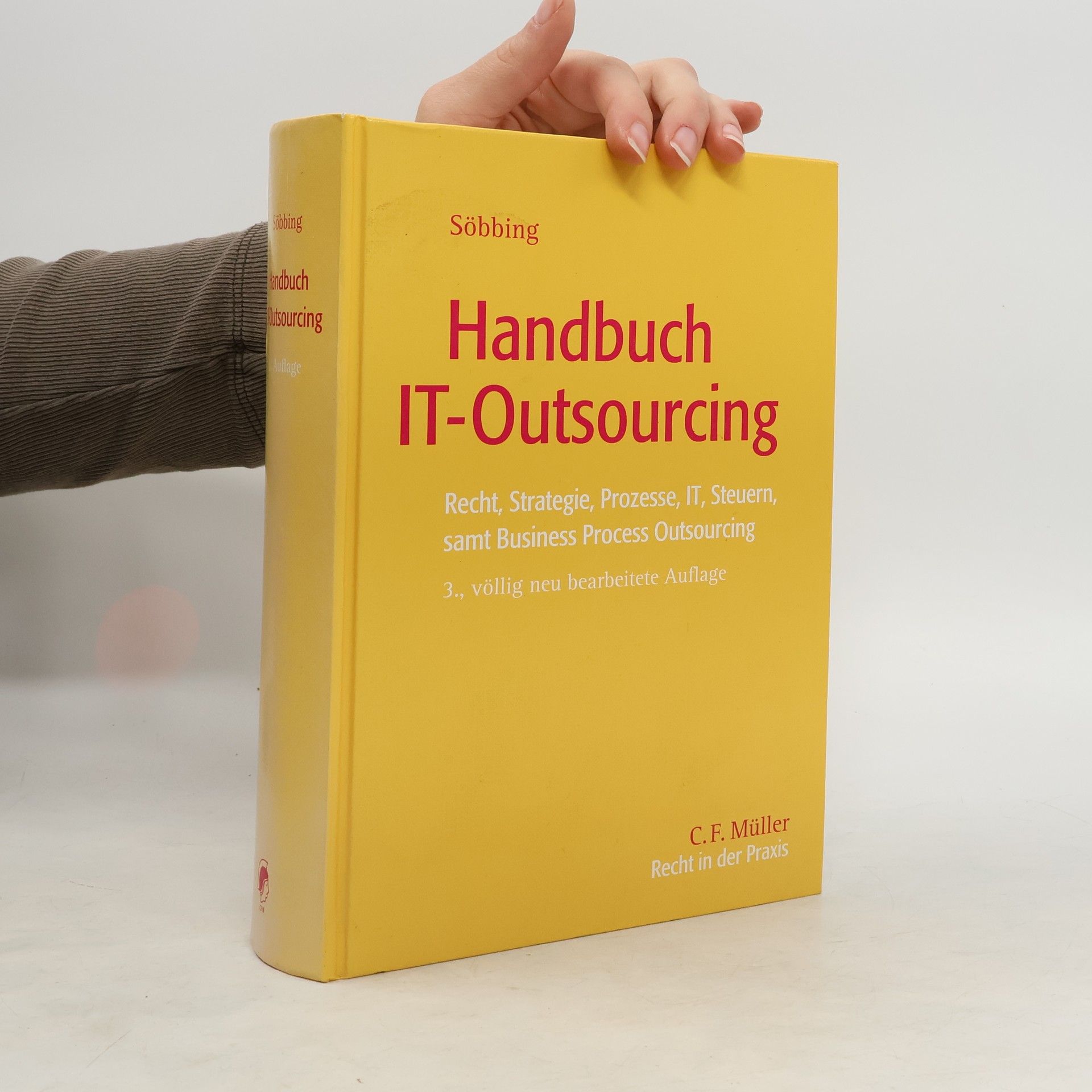


Diese wissenschaftliche Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, warum Vertragsverhandlungen scheitern und ob es zwischen politischen Verhandlungen und Verhandlungen im ökonomisch-juristischen Umfeld Parallelen gibt. Anhand der Indikatoren „Scheitern aus Arroganz“ und „Überheblichkeit“ sowie der „völligen falschen Einschätzung der Situation“ werden konkrete Verhandlungen analysiert und bewertet. Als Fallstudien werden die Verhandlungen zur Ampelkoalition in Berlin 2001, die Fusionsverhandlung zwischen Deutscher- und Dresdener Bank 2000, die Verhandlung zur UN-Friedens-Resolution 2003 sowie die gescheiterten Vertragsverhandlungen zwischen der Commerzbank und IBM aus Jahre 2003 herangezogen.
Die Autoren: Der Autor Thomas Söbbing ist Vertragsjurist bei einem Outsourcing-Dienstleister und ehemaliger Unternehmensberater. Er war Lehrbeauftragter einer juristischen Fakultät und hat zahlreiche Publikationen zum Thema Outsourcing veröffentlicht. Ferner ist er Vice President der European Outsourcing Association e. V., Dozent bei den führenden Anbietern von Management-Seminaren und Berater des Handelsblattes. Die Co-Autoren sind Rechtsanwälte und Steuerberater in namhaften Kanzleien und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Sie sind anerkannte Experten auf ihren jeweiligen Gebieten.