Focusing on the 'Pear Theft' episode in St Augustine's Confessions, this book delves into its secular insights rather than solely its theological implications. It examines the event's significance in understanding joint action and collective wrongdoing, offering a fresh perspective on moral philosophy and human behavior. Through this exploration, the author aims to contribute to the discourse surrounding ethics and accountability in shared actions.
Hans Bernhard Schmid Libri
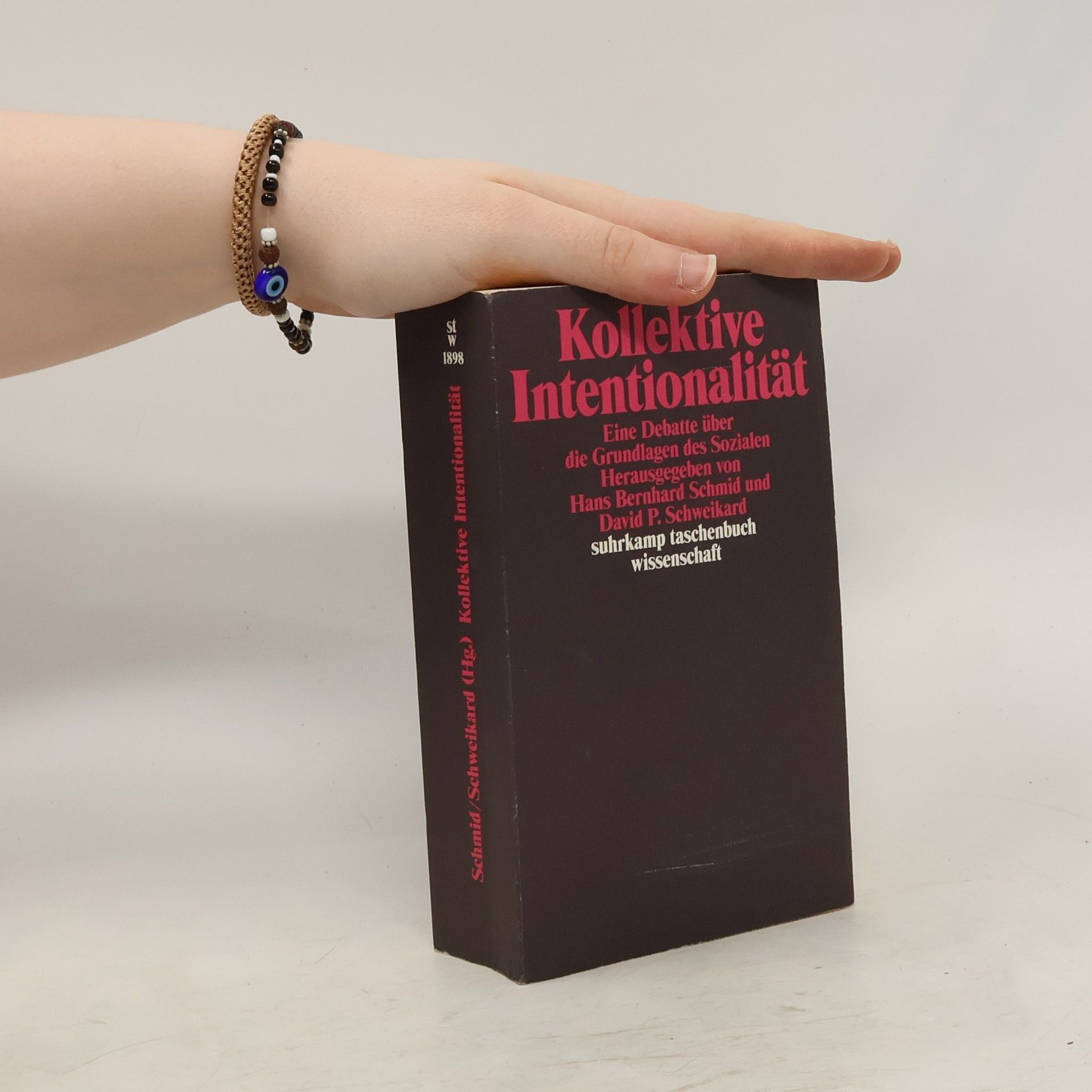

Die überwältigende Anzahl sozialer Phänomene ist dadurch gekennzeichnet, daß Menschen Absichten und Überzeugungen miteinander teilen, mit vereinten Kräften handeln und gemeinsame Praktiken sowie soziale Institutionen etablieren. Seit etwa zwei Jahrzehnten werden die begrifflichen Grundlagen und Besonderheiten dieser Phänomene unter dem Stichwort »Kollektive Intentionalität« zusammengefaßt und zunehmend interdisziplinär diskutiert. Dieser Band bietet das erste umfassende Kompendium zu dieser Debatte über die Grundlagen des Sozialen und versammelt erstmals in deutscher Übersetzung neben den klassischen philosophischen Texten auch neuere Beiträge aus angrenzenden Wissenschaften. Eine systematische Einleitung der Herausgeber erschließt die Hauptlinien und Hintergründe der Diskussionen.