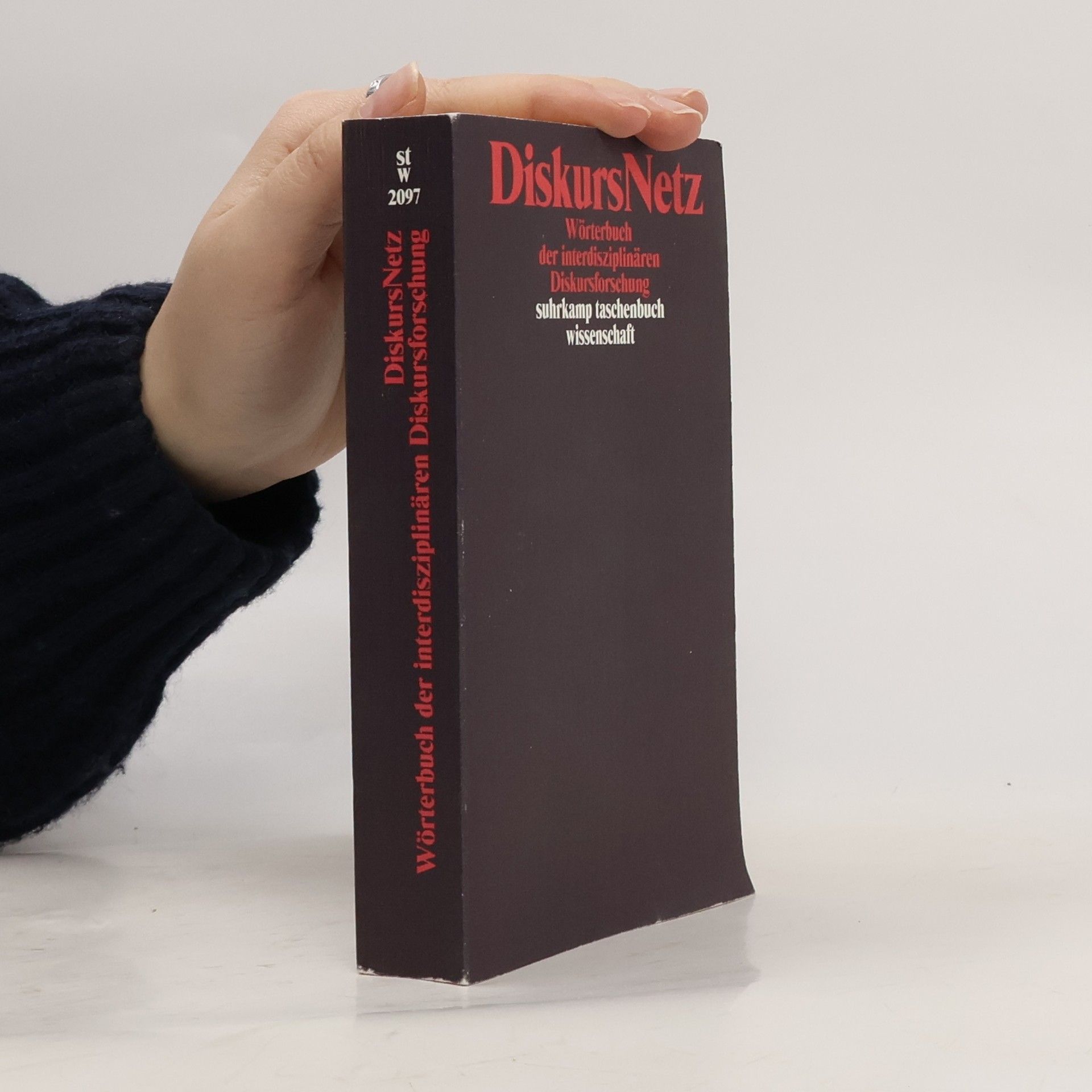Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft - 2097: DiskursNetz
Wörterbuch der interdisziplinären Diskursforschung
- 569pagine
- 20 ore di lettura
Die Diskursforschung hat sich in den letzten Jahrzehnten auch im deutschen Sprachraum als ein dynamisches Forschungsfeld etabliert. Ihre terminologische Vielfalt ist allerdings selbst für Spezialistinnen und Spezialisten kaum mehr zu überblicken. Dieses Wörterbuch – das erste seiner Art – kommt dem steigenden Bedarf nach Verständigung über disziplinäre Grenzen hinweg nach. Mit seinen 554 Einträgen deckt es die Breite der Diskursforschung in Philosophie, Soziologie, Politikwissenschaft, Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, Medien- und Kommunikationswissenschaft, Geschichtswissenschaft, Psychologie, Erziehungswissenschaft und Geographie ab. Ein unentbehrliches Kompendium für jeden Diskursforscher.