Journal für Entwicklungspolitik 3/2008. Wachstum - Umwelt - Entwicklung
- 124pagine
- 5 ore di lettura

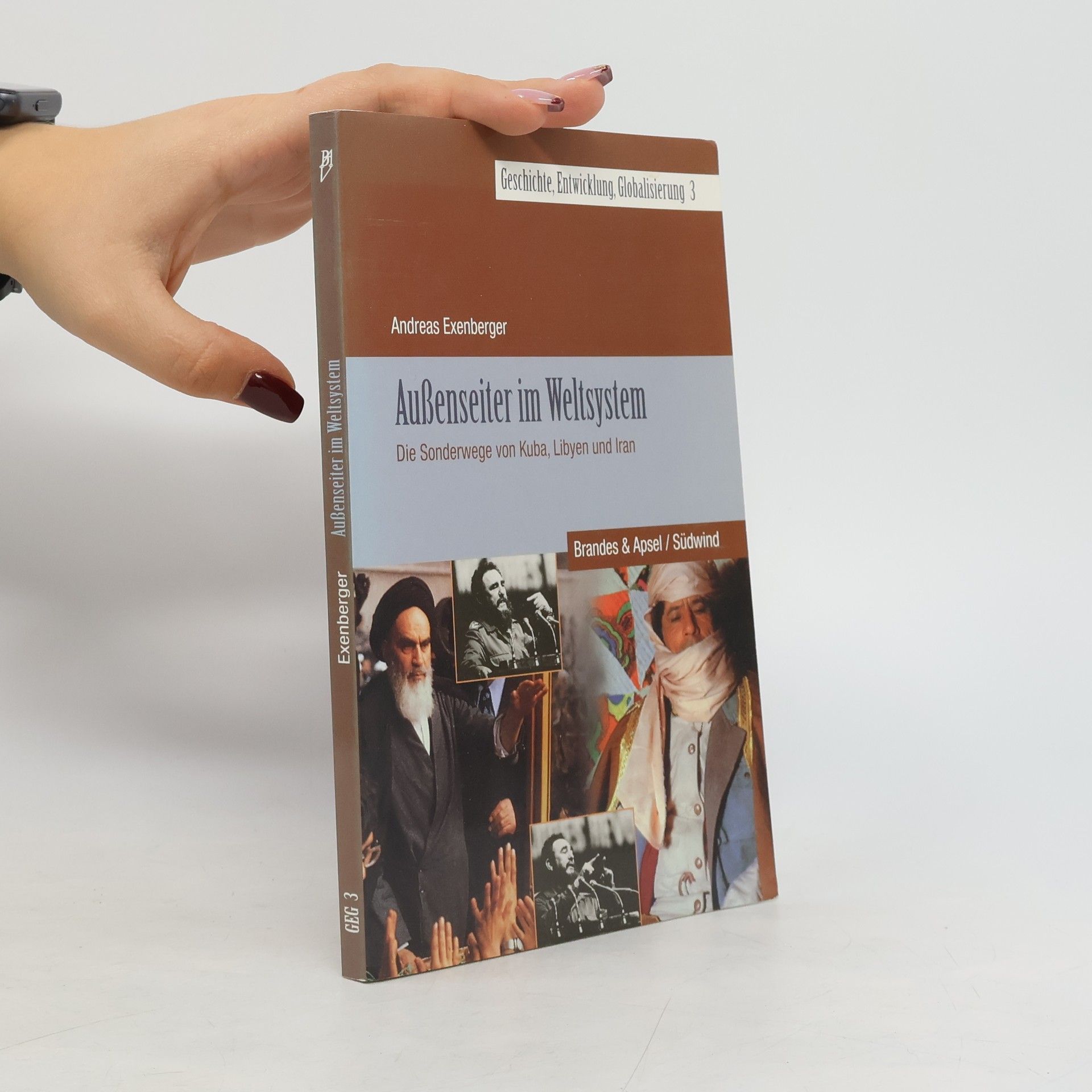

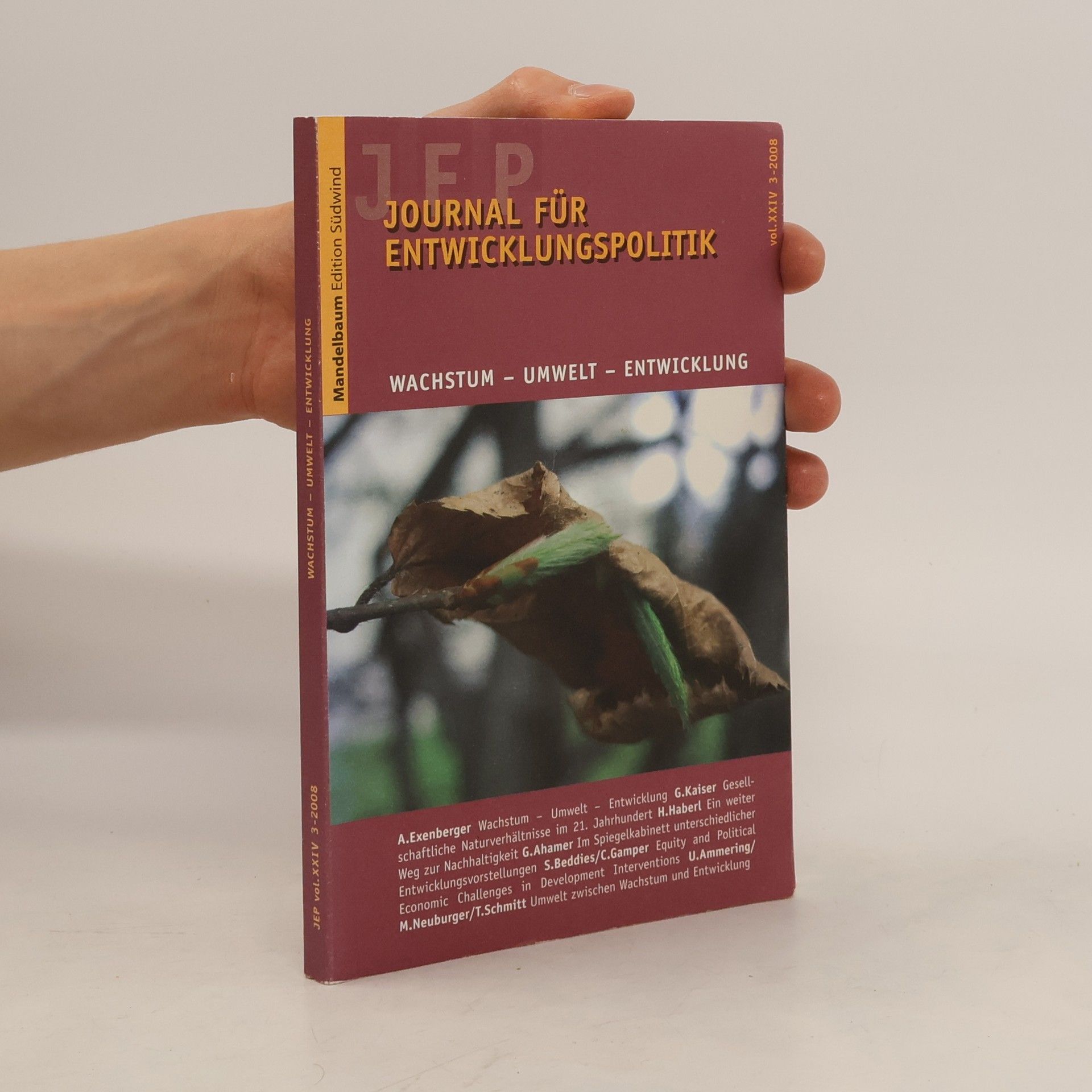
Die Sonderwege von Kuba, Libyen und Iran
Aussenseiter im Weltsystem Die Sonderwege von Kuba, Libyen und Iran
Kufsteiner Sportgeschichte von den Anfängen bis heute
„Triumphe, Niederlagen und Volksvergnügen“, all das gehört zum Sport dazu. Doch welchen Sportarten man gerade in Kufstein seit der Zeit um 1900 nachging, welche Siege man einfuhr und welche Vereine den größten Zulauf hatten, das hat Andreas Exenberger nun erstmals systematisch erhoben. Der Wirtschafts- und Sporthistoriker erzählt von Kufstein, der Hochburg des Schlittensports, der Heimat erfolgreicher Faustballer und dem Austragungsort des Bambini-Turniers der jungen Tennisprofis. Ausführlich legt er die Geschichte des Fußballs dar, der zeitweise mit vier Vereinen in der Stadt vertreten war. Leidenschaftlich vom Publikum verfolgt, boten die Spiele der Kufsteiner Kicker reichlich Spannung und auf regionaler wie nationaler Ebene auch so manchen Sieg. Dass die größten Kufsteiner Erfolge aber in Sportarten wie Tischtennis oder Baseball gelangen und Kufsteiner Olympioniken im Skeleton, Rennrodeln, Judo und Segeln antraten, zählt zu den vielen erstaunlichen Erkenntnissen zur Sportgeschichte der Stadt im 20. und 21. Jahrhundert.