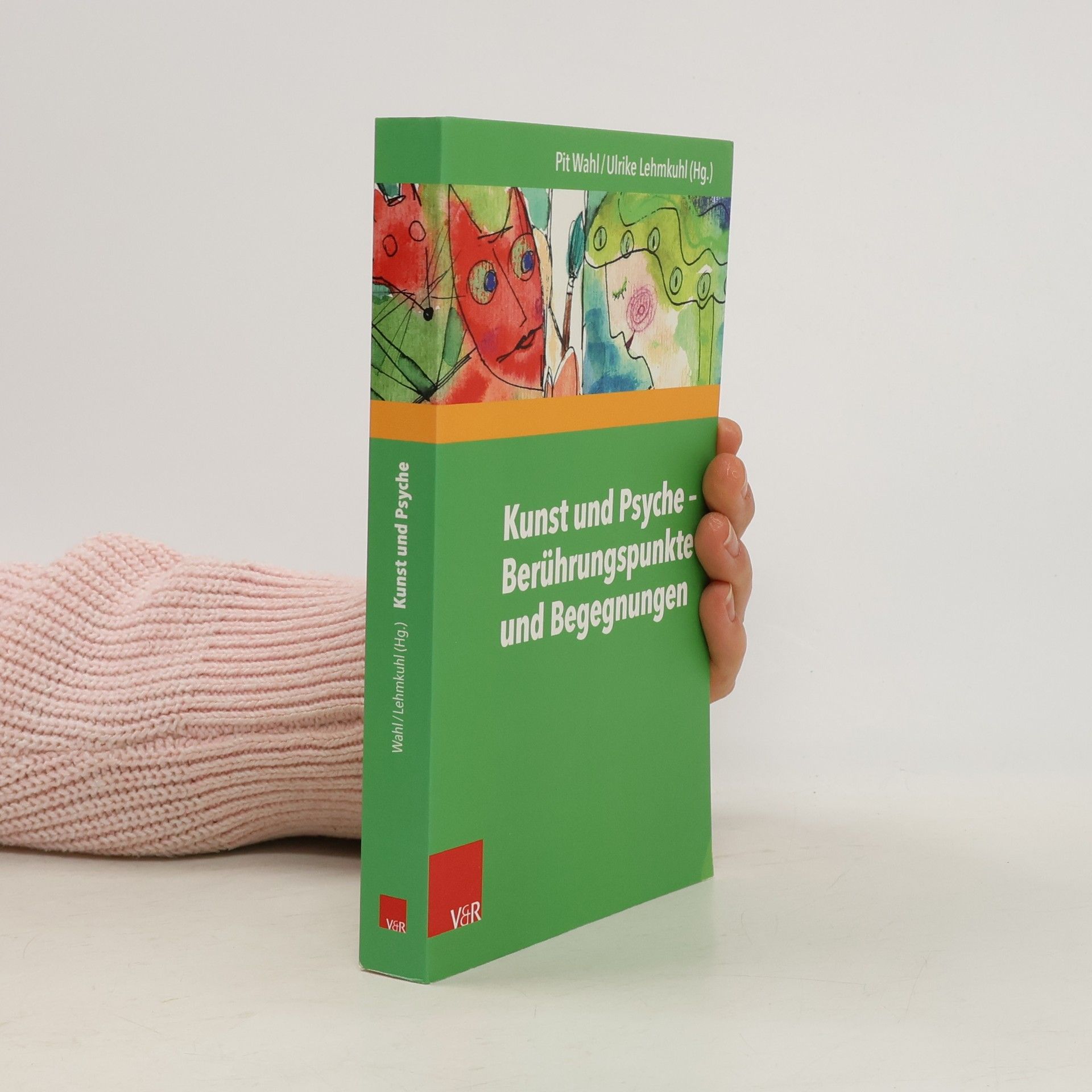Beiträge zur Individualpsychologie - 41: Kunst und Psyche – Berührungspunkte und Begegnungen
- 306pagine
- 11 ore di lettura
Welchen Stellenwert haben künstlerische Perspektiven auf die menschliche Psyche? Und für die Seelenarbeit? Ermöglicht das theoretische Wissen über die Dynamik des Seelischen einen besseren Deutungszugang zum Verständnis von Kunstwerken? Lässt sich künstlerisches Gestalten psychotherapeutisch anwenden? Ist psychoanalytische Praxis eine Kunstform? Die Felder Kunst und Psychoanalyse wissen beide um die entscheidende Bedeutung unbewusster Phänomene. Es handelt sich um eine höchst inspirierende wechselseitige Bezogenheit, die gerade in der Konfrontation, im Widerspruch, in der Irritation und selbst in der Provokation ein ungemein innovatives Potenzial besitzt. Die Zusammenschau von Kunst und Psyche gibt Einblicke in seelische Abläufe. Indem die Beiträge des Bandes der Deutschen Gesellschaft für Individualpsychologie bildende Kunst, Literatur, Musik und Film als Spiegel seelischen Geschehens interpretieren, generieren sie psychologisches Wissen. Insofern als künstlerische Gestaltung selbst in Therapie und Beratung einbezogen werden kann, entstehen neue, besondere Begegnungs- und Berührungszusammenhänge zwischen Kunst und Psyche.