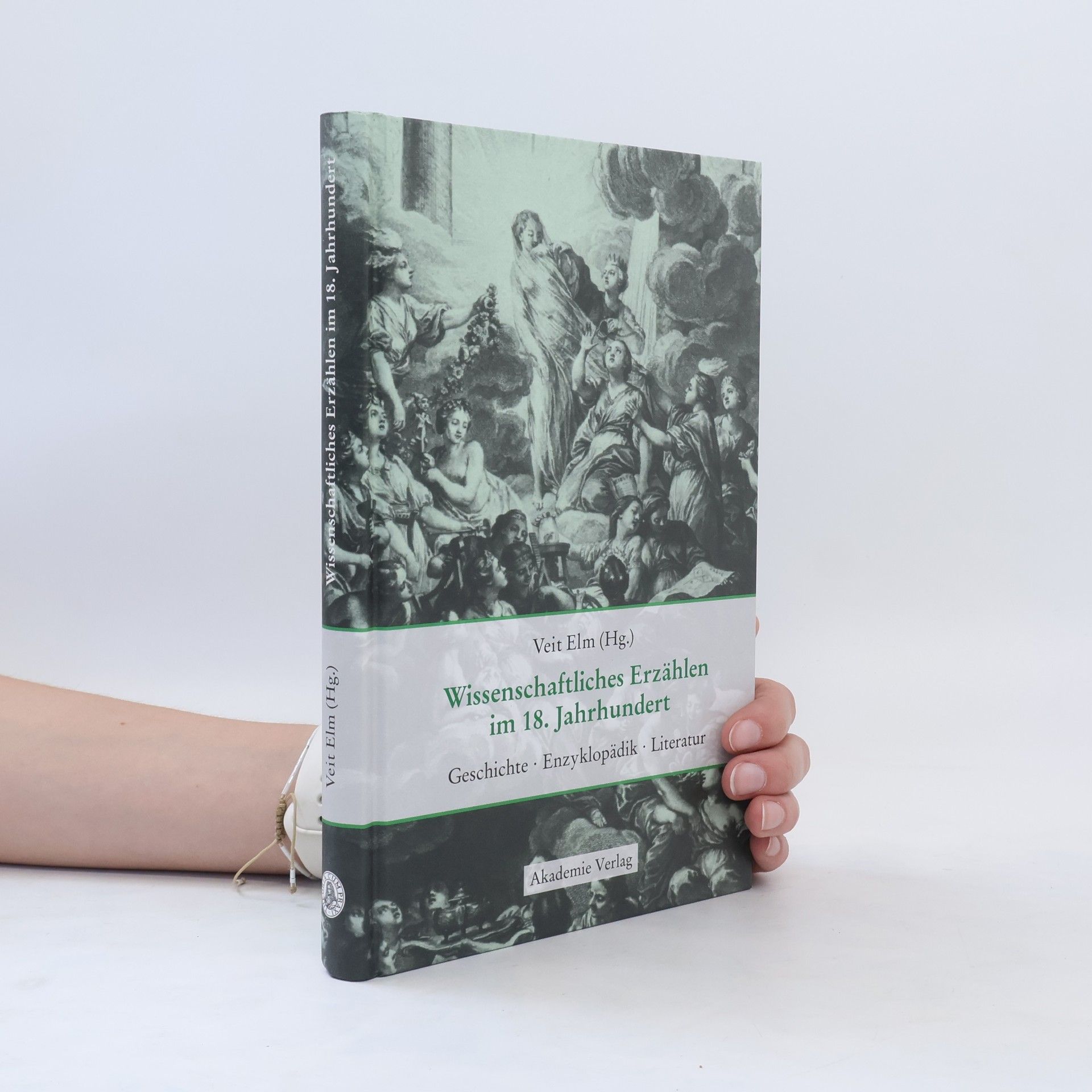Die narrativistische Kritik am Wissenschaftsverständnis der Geschichtsschreibung und die Erweiterung der Wissenschaftsgeschichte zur Geschichte des Wissens haben die Auseinandersetzung mit der Geschichtsschreibung des 18. Jahrhunderts grundlegend verändert. Geschichtsschreibung und Geschichtsphilosophie werden als literarisches Phänomen wahrgenommen, deren Wissenschaftsansprüche im Kontext zeitgenössischer Wissensideale historisiert werden können. Trotz dieser Umbrüche folgt die Beschäftigung mit der Geschichtsschreibung in Deutschland weiterhin alten Mustern, wie der Gegenüberstellung von Aufklärung und Historismus sowie der Projektion gegenwärtiger Methodendiskussionen in das 18. Jahrhundert. Aufklärung wird oft mit Scientismus und Historismus mit dessen Kritik gleichgesetzt. Ziel dieses Bandes ist es, den eingeschränkten Blick auf die deutsche Aufklärung zu erweitern, die Gleichsetzung von Aufklärung und Scientismus zu hinterfragen und das Medium der Erzählung in den Fokus zu rücken. Dabei wird erinnert, dass sich die „philosophische“ Geschichtsschreibung im Frankreich des späten 17. Jahrhunderts entwickelte, als Cartesianismus, Pyrrhonismus und Enzyklopädik die Erzählung als Wissensmedium einer radikalen Kritik unterzogen. Die Beiträge beleuchten den Aufstieg der Erzählung im Laufe des Jahrhunderts vom Paria der Wissensordnung an deren Spitze.
Veit Elm Libri