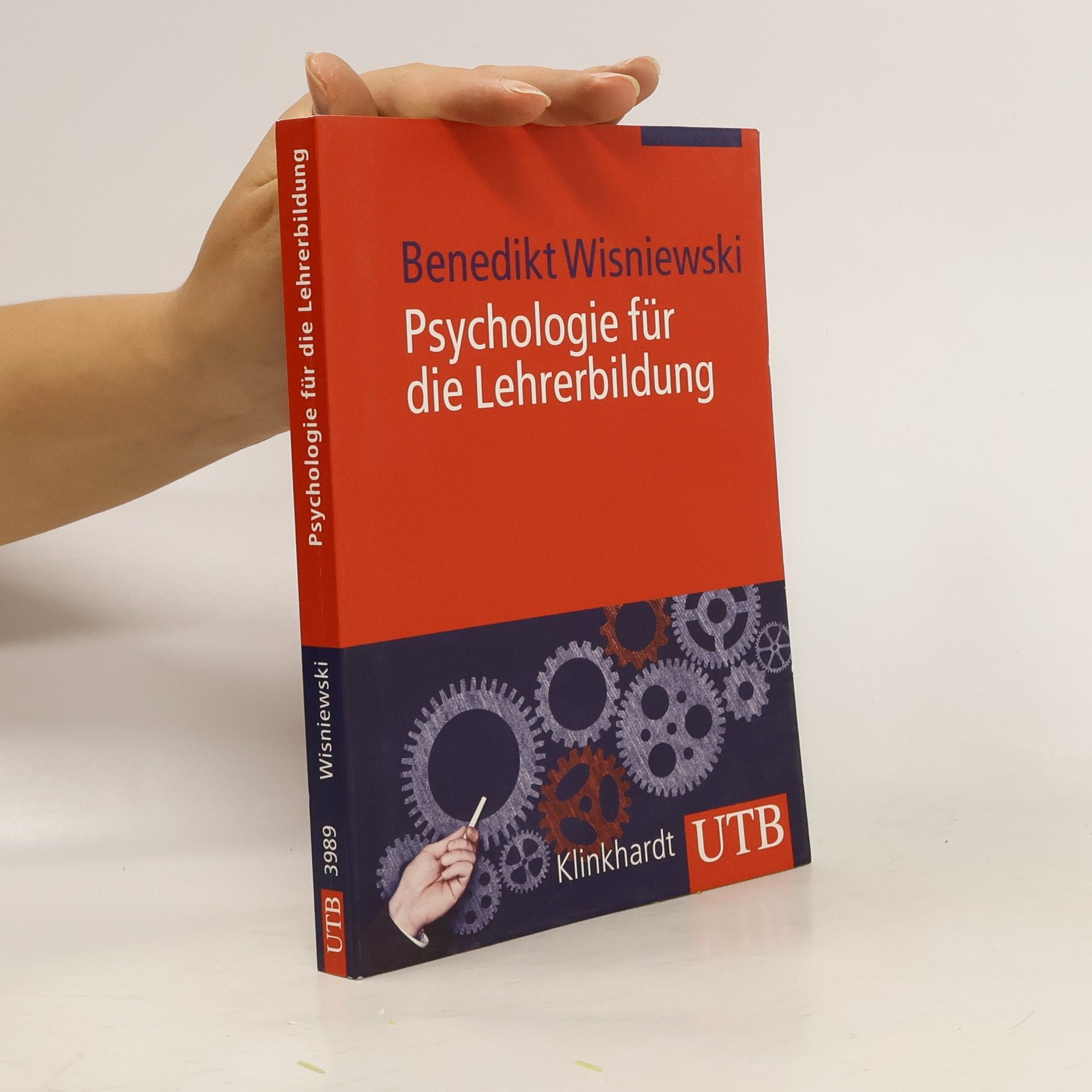Das Manual „Psychologie für die Lehrerbildung“ ist eine Zusammenstellung psychologischer Inhalte, die für angehende Lehrer von Bedeutung sind. Die pädagogisch relevanten Inhalte der Persönlichkeitspsychologie, der Entwicklungspsychologie, der Sozialpsychologie und der Psychologie des Lernens und Lehrens werden verständlich und im Hinblick auf ihre jeweiligen Implikationen für die schulische Praxis dargestellt. Hier erhalten Sie eine praxisbezogene Zusammenfassung der psychologischen Inhalte, die im erziehungswissenschafltichen Teil des Studiums und des Referendariats erworben werden sollen.
Benedikt Wisniewski Libri