Problembewusstsein und Philosophie
Unvollständige Operationen und ausstehende Lösungen. Wo die Doctrina nicht Lectura werden konnte (10 Essays)
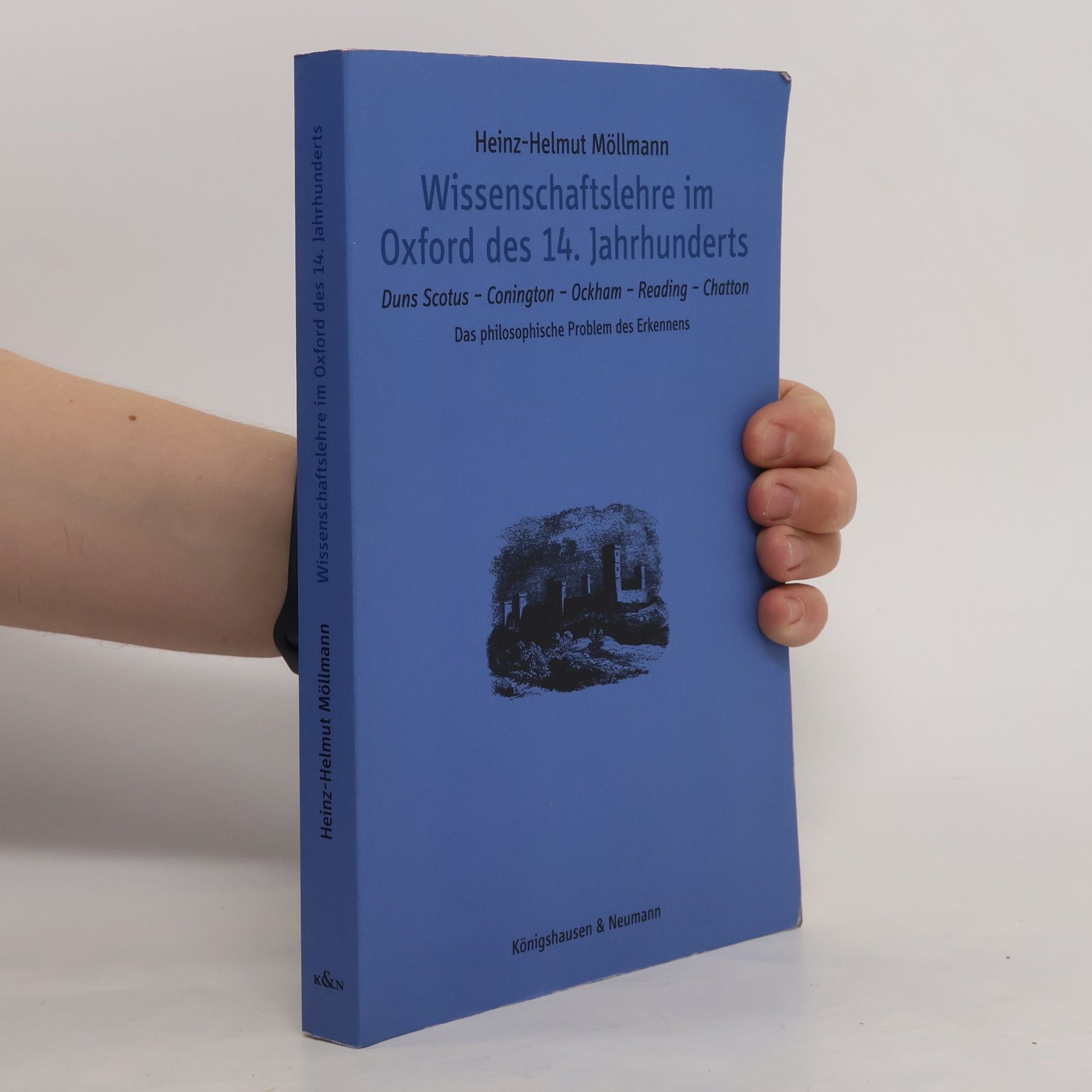


Unvollständige Operationen und ausstehende Lösungen. Wo die Doctrina nicht Lectura werden konnte (10 Essays)
Das Mittelalter als Zeitraum der Experimente. Interpretationen zu scholastischen Quaestionen
Aus einem kleinen Stamm von Kernbegriffen und Phänomenen wie Erkenntnis, Satz, Begriff, syllogistischer Beweis, Konsequenz soll die Lehre Wilhelm Ockhams (1285-1347) entwickelt werden. Dabei zeigt sich, dass sie der neuzeitlichen Wissenschaft noch nicht angehört, doch so etwas wie deren Aura darstellt. Im Zentrum der Analysen werden Ockhams Wissenschaftslehre im unmittelbaren Vergleich mit den verwandten Bemühungen von Ockhams Oxforder Zeitgenossen stehen, daneben seine Kritik an Johannes Duns Scotus und an Petrus Aureoli bezüglich der Grundlagen der Erkenntnis und der Theologie. Eine so begrenzte Basis soll aber gerade für die Erörterung geschichtlicher Wirkungsweise nutzbar gemacht werden.