Mythos Reichsautobahn
- 179pagine
- 7 ore di lettura
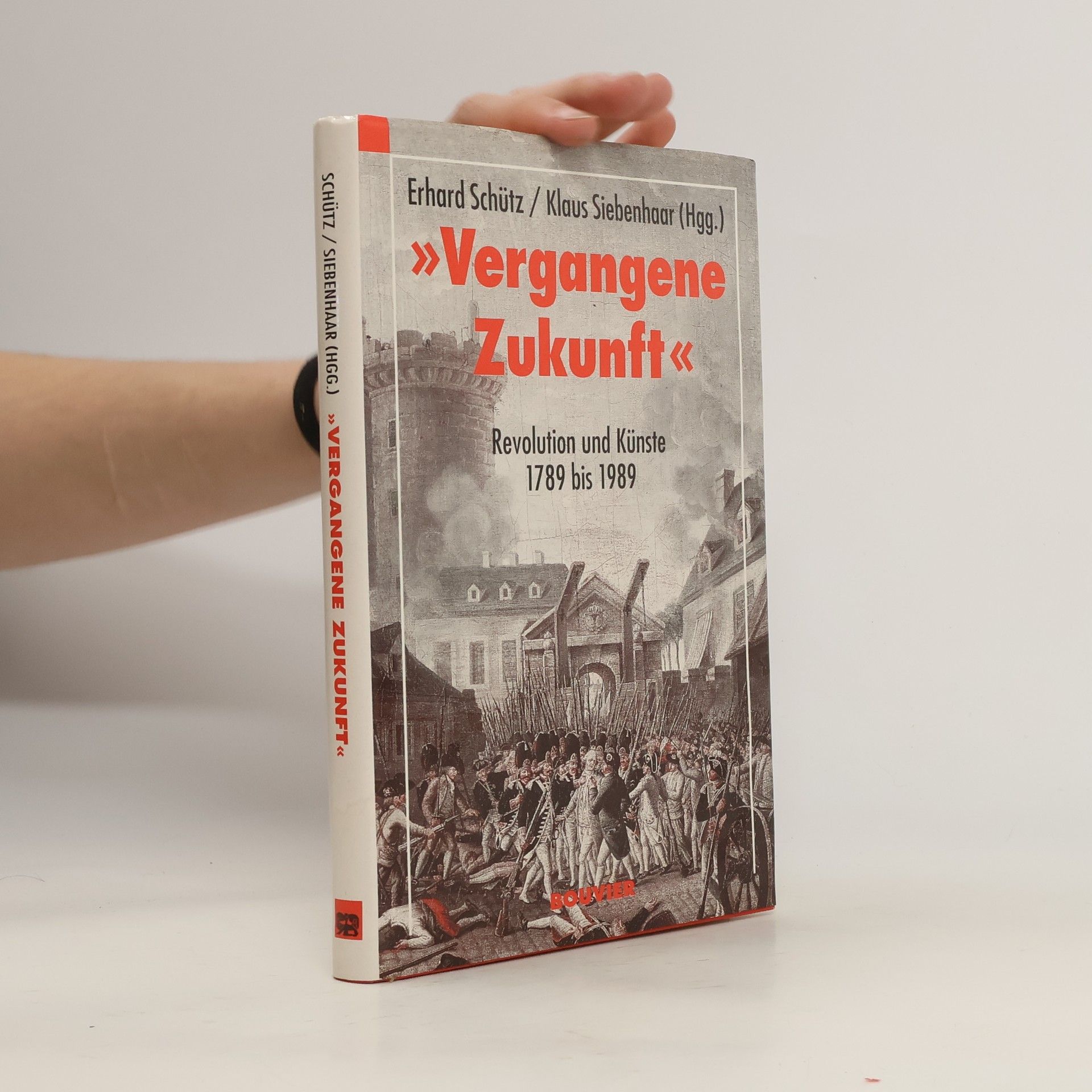

![Einführung in die deutsche Literatur des 20. [zwanzigsten] Jahrhunderts](https://rezised-images.knhbt.cz/1920x1920/37972700.jpg)

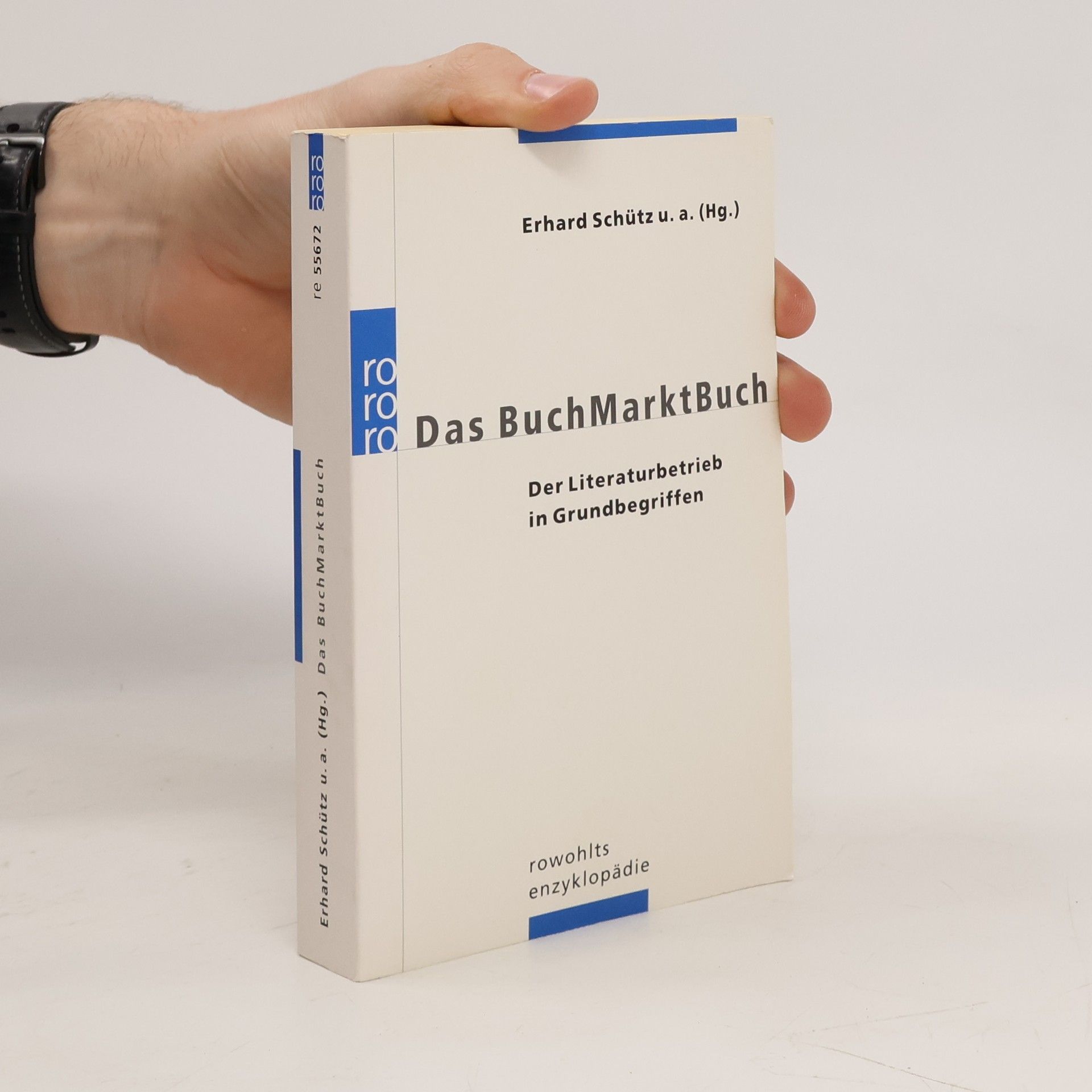
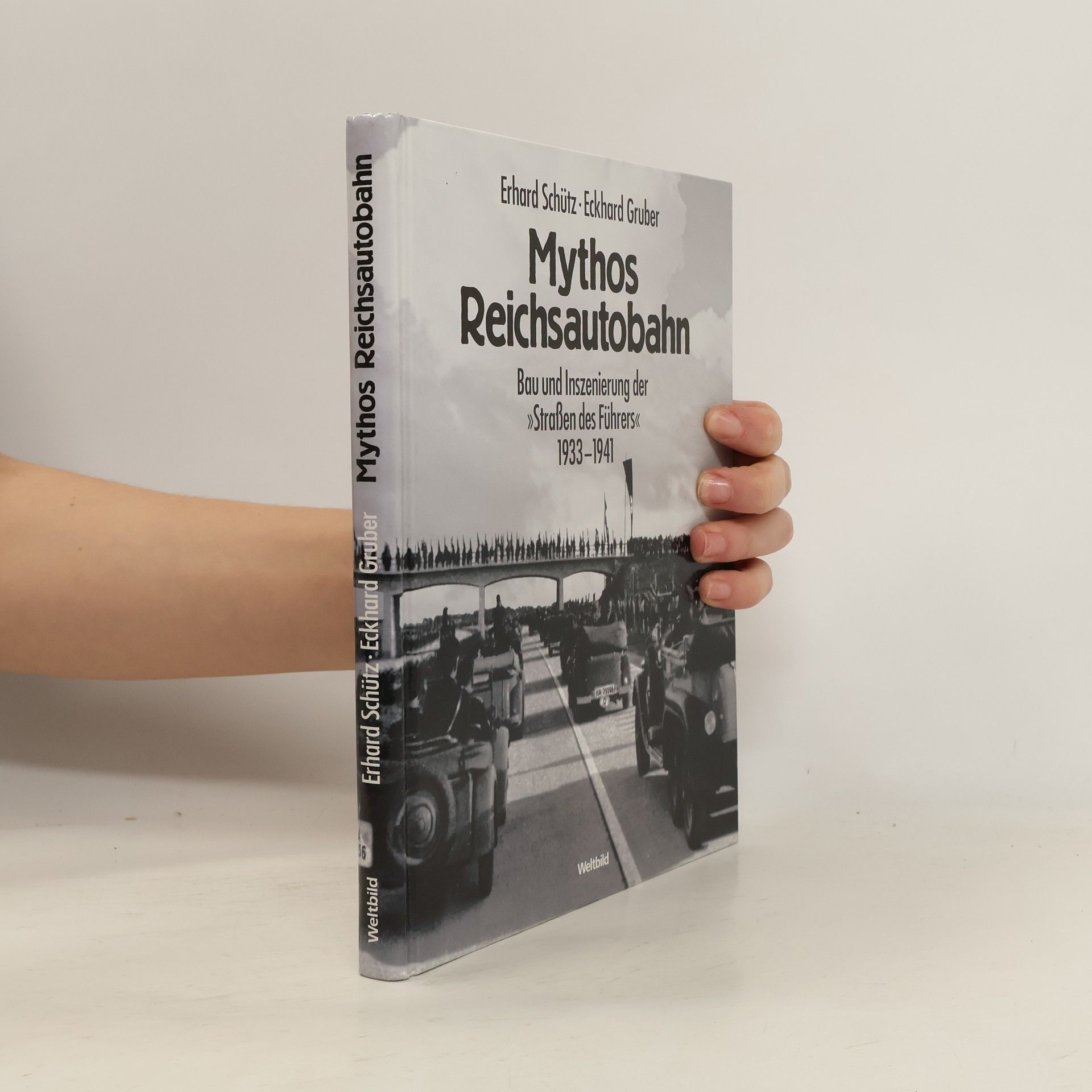
In ca. 120 Artikeln werden betriebswirtschaftliche, branchenspezifische sowie literatur- und medienwissenschaftliche Termini aus der Buchbranche erklärt.
Band 1: Keiserreich
Widerspruchsfreiheit ist eine Mangelerscheinung oder ein Widerspruch Hans Magnus Enzenberger. Die Überlegungen zur Einführung, die wir im ersten Band angestellt haben, gelten auch für diesen dritten. Seine verspätete Veröffentlichung im Vergleich zu den vorhergehenden Bänden ist nicht nur auf interne Probleme zurückzuführen. Vielmehr hat die hochschuldidaktische Präsentation und Diskussion der behandelten Themen in einer Teamvorlesung im Sommer 1977 verdeutlicht, dass eine schärfere Konturierung der Nachkriegsliteratur und ihrer Bedingungen erforderlich ist. Dies betrifft grundlegende Fragen, wie die angemessene Perspektivierung eines Zeitabschnitts, der sowohl Geschichte ist als auch bis in die Gegenwart reicht. Auch die Zeitabgrenzung selbst musste überdacht werden. Während die Abgrenzung nach „hinten“ dem gängigen Verständnis folgt und 1945 als Zäsur setzt, wird die Kontinuität gewisser literarischer Teile mit der Zeit davor nicht negiert. Dennoch hat sich nach dem Kriegsende, sowohl politisch als auch in den personellen Konstellationen, eine „neue“ literarische Situation ergeben. Die Frage nach der Grenzziehung in Richtung literarischer Aktualität stellte sich auch im Hinblick auf die Auswahl der zu behandelnden Autoren. Wir haben uns entschieden, die Reflexion jüngster Verhältnisse in den Werken älterer Autoren zu berücksichtigen.
Aus dem Literatur im Zeitalter der Medienkonkurrenz / Heinrich Mann I / Thomas Mann I / Remarque, Renn Jünger / Karl Kraus / Franz Kafka / Kabarettkultur / Gottfried Benn / Bertold Brecht Lyrik / Volksstü Zuckmayer, Fleißer, Horvàth / Piscator-Bühne / Bertold Brecht Lehrstück-Konzept / Alfred Döblin / Robert Musil / Reger, Hauser, Kisch / Literatur der Arbeiterbewegung Prosa / Literatur der Arbeiterbewegung Lyrik / Literatur der Arbeiterbewegung Drama / Literatur des deutschen Faschismus / "Innere Emigration" / Literatur im Exil / Bertold Brecht Exildramen / Heinrich Mann II / Thomas Mann II.
Geld regiert die Welt. Zwar ist das so, auch in Deutschland – auch in Deutschland. Nur gehört es hierzulande zum guten Ton, sich nicht allzu detailliert über Finanzen auszulassen. Doch es gab einmal eine Zeit, da redeten und schrieben alle vom Geld. Es lag buchstäblich auf der Straße und es war tagtäglich in allen Zeitungen: die große Inflation 1923. Die hier versammelten Texte geben einen unmittelbaren Eindruck in das Verhalten und die Mentalität jener Zeit. Chronologisch angeordnet, lassen sie erahnen, was alles gleichzeitig in den Köpfen vorging – denen der Autorinnen und denen der Menschen, an die sie sich wandten –, die sie erheitern oder beschwichtigen wollten, um ihnen die Situation zu illustrieren, anekdotisch zu erläutern oder zumindest kurzfristig gute Laune zu machen. Der Sog, der immer schneller kreisende Wirbel lässt sich auch heute noch nachvollziehen. Andererseits die Erleichterung und dann die Wut, als der „Spuk“ vorüber war. IN den Geschichten von Profiteuren, Verlierern oder glimpflich Davongekommenen entsteht damit ein Sitten- und Gesellschaftsbild ganz besonderer Art.