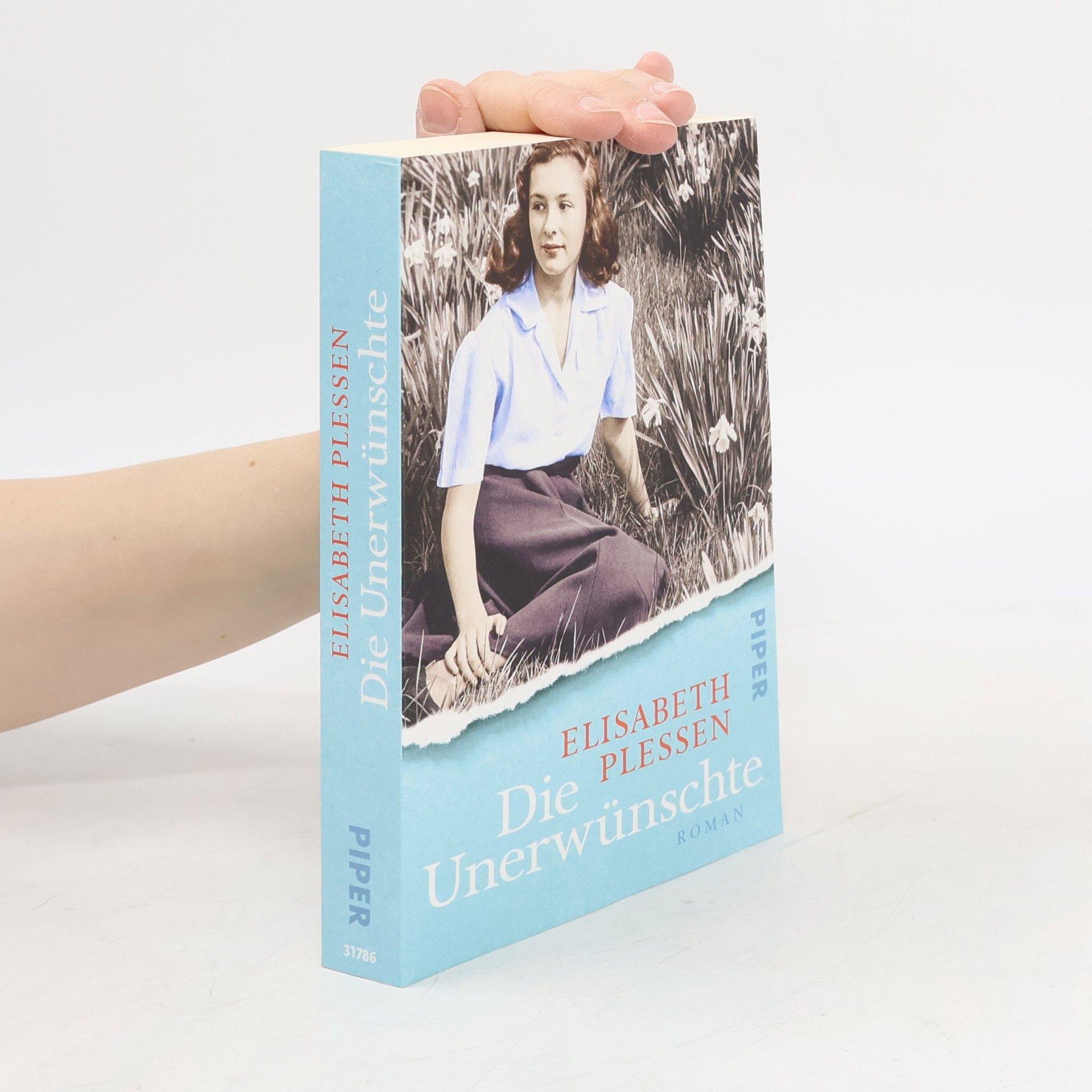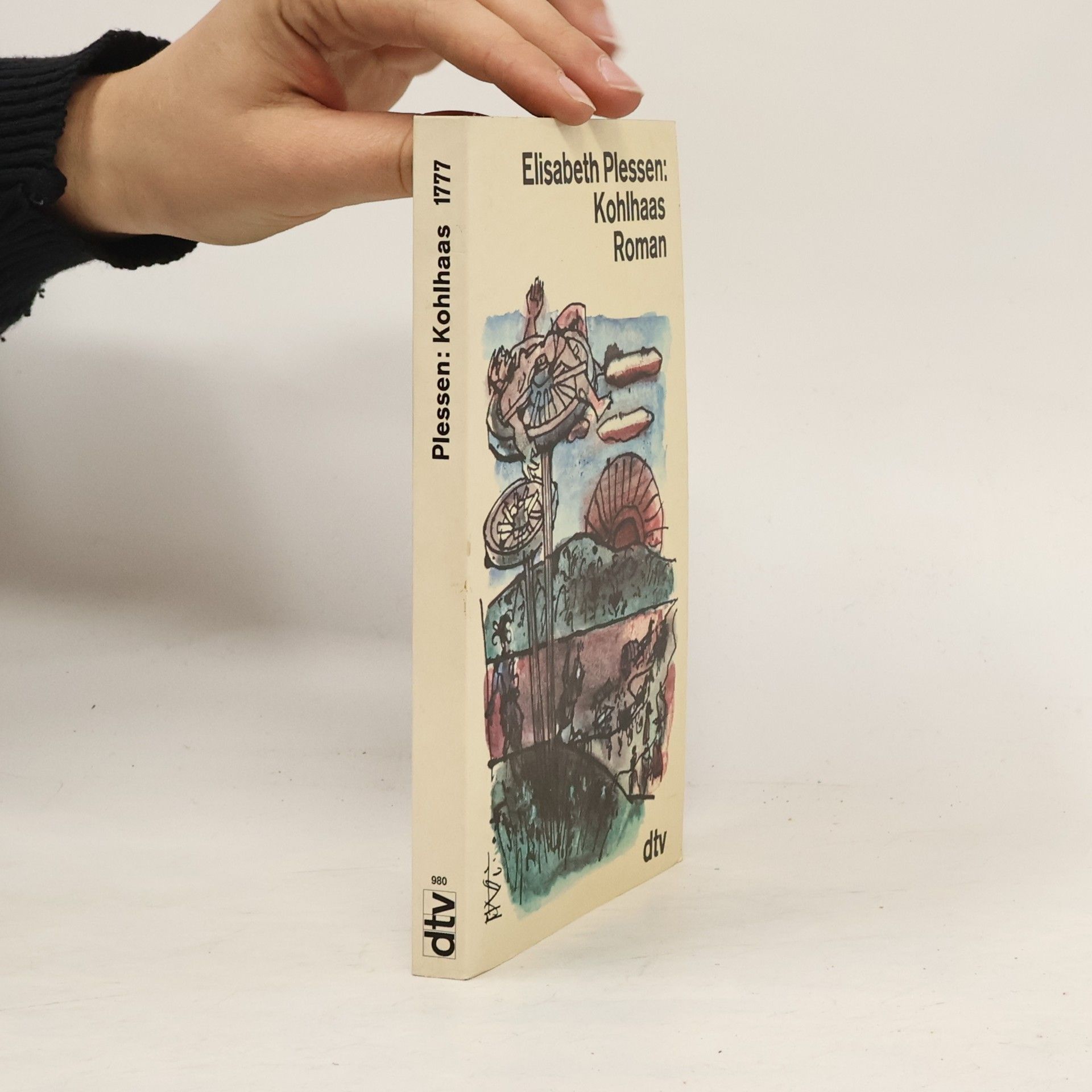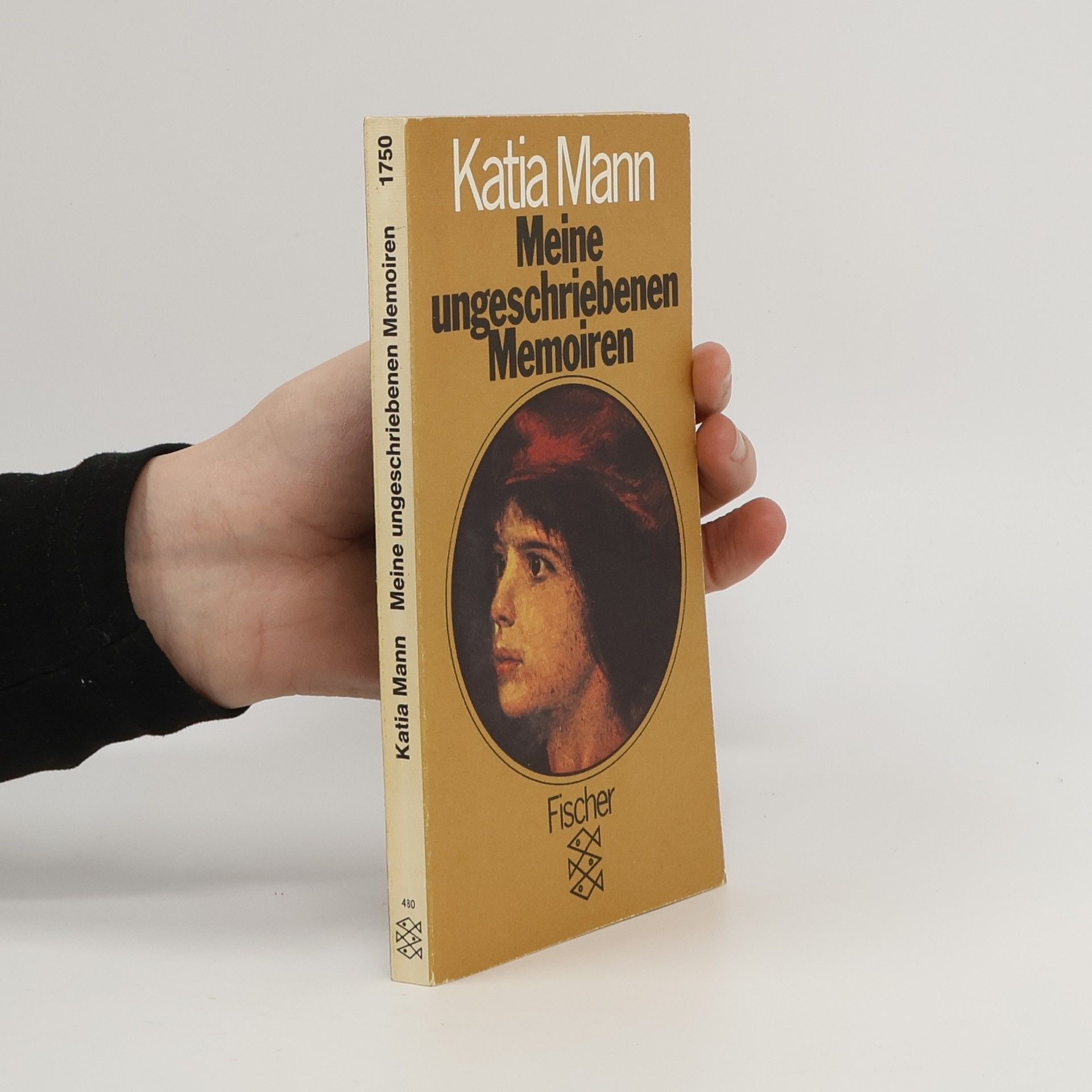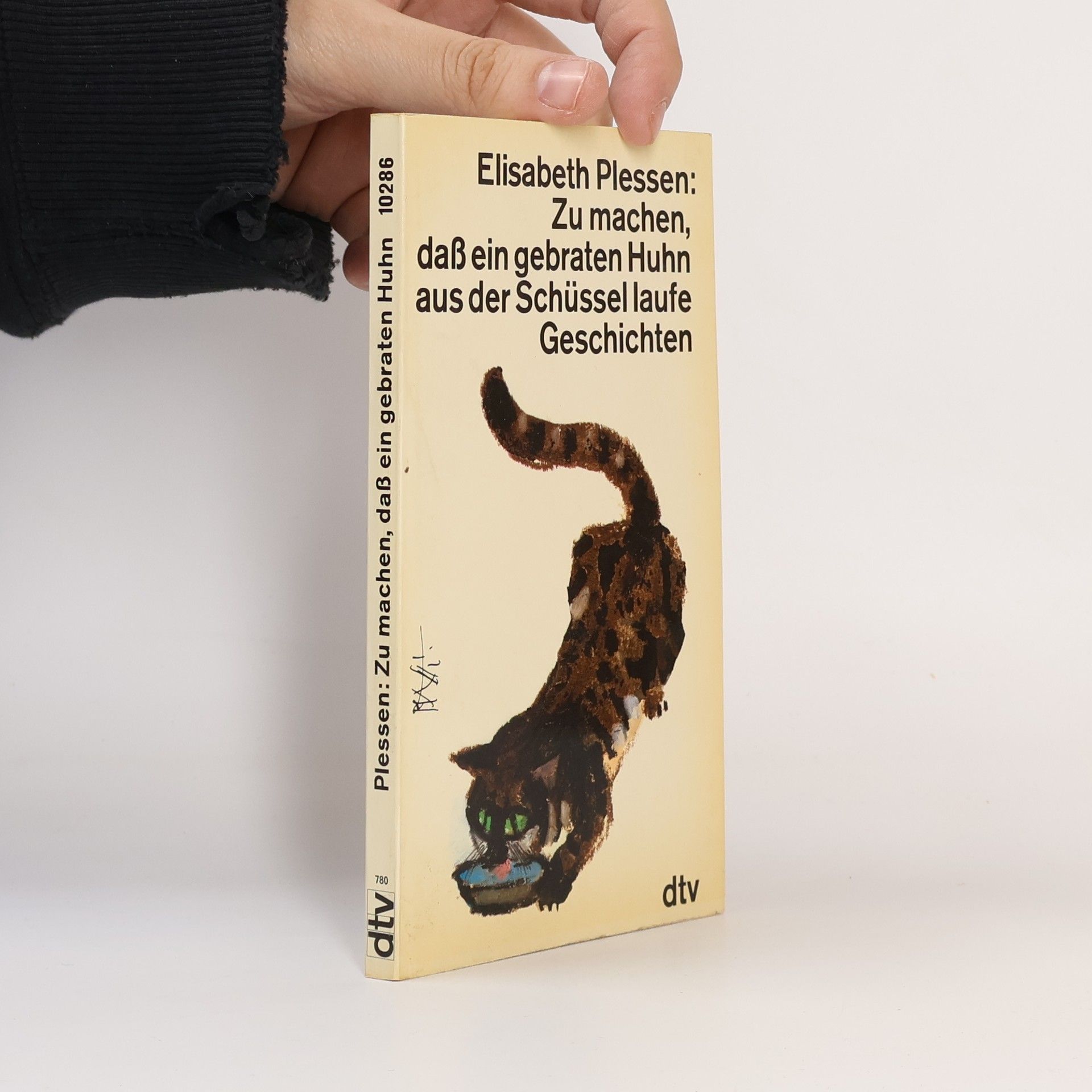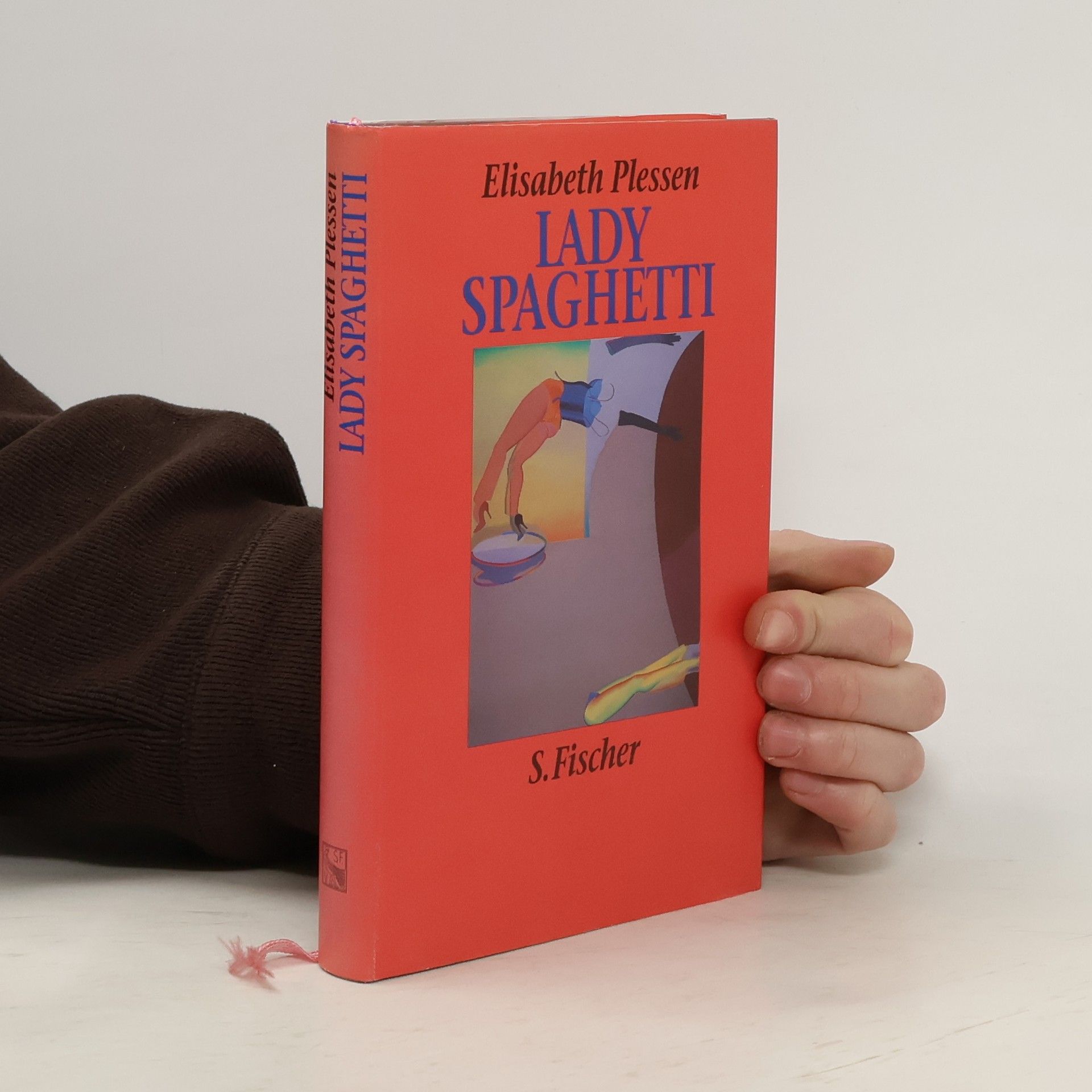Die Frau in den Bäumen
- 192pagine
- 7 ore di lettura
»Wir hatten Zeit, Liebe schafft Zeit.« Anna ist Ende zwanzig, hat das Studium beendet und steht vor dem Neuanfang, als sie mit Leo gen Italien aufbricht. Nach Tagen der nicht nur hochsommerlicher Hitze geschuldeten Apathie reißt ein Gewitter die beiden aus dem Trott und Anna gleich ganz aus ihrem bisherigen Leben: Die Nachricht vom Tod ihres Vaters fällt zusammen mit dem Kennenlernen von Matteo, einem Regisseur, der sie nach Rom lockt und dann auf eine Insel. Und da ist Robert, zu dem Anna sich aus anderen Gründen hingezogen fühlt. Fest steht allein, dass nichts so bleiben kann, wie es ist, denn das Leben steht offen vor ihr. Eine literarische Sommerreise ins Italien der 1970er Jahre