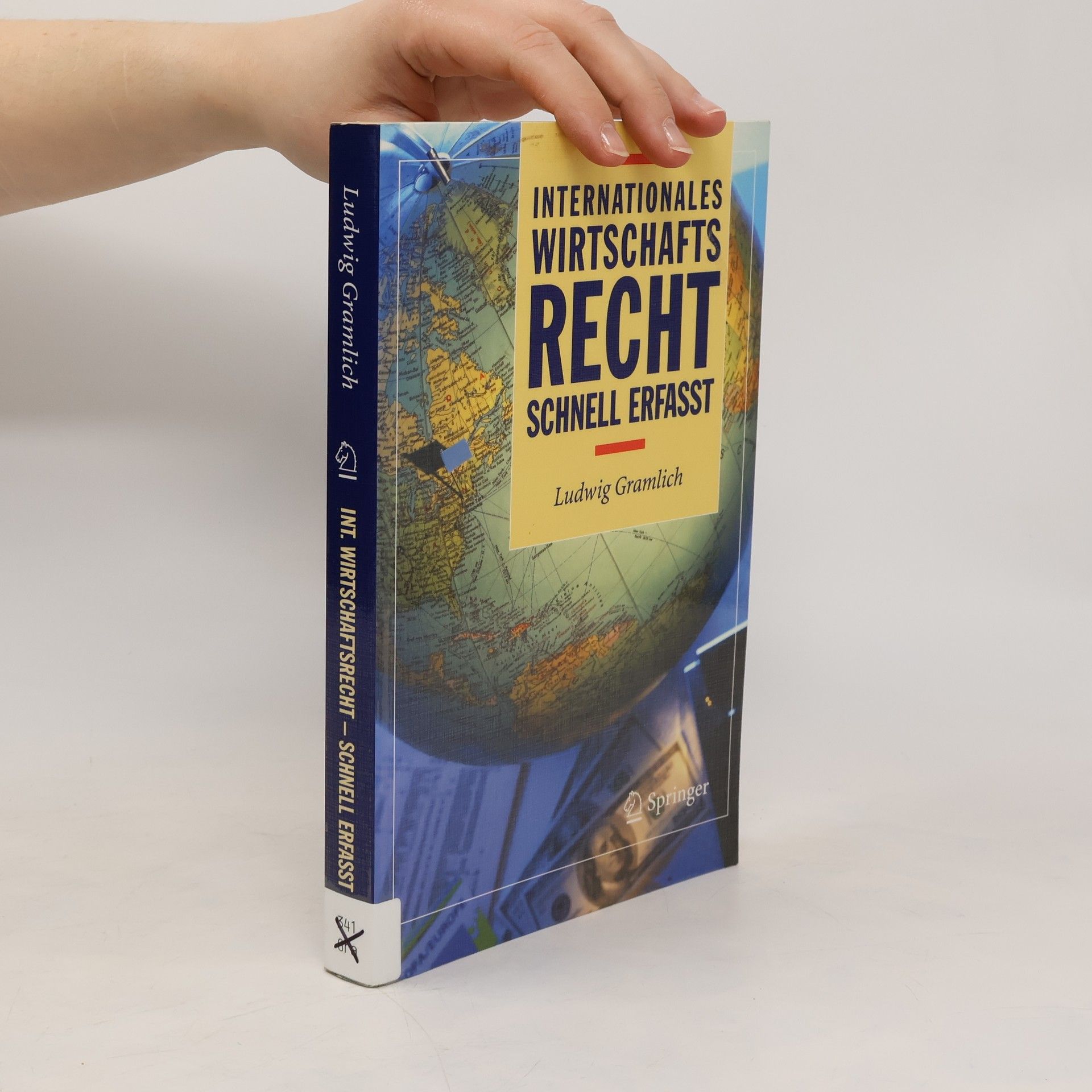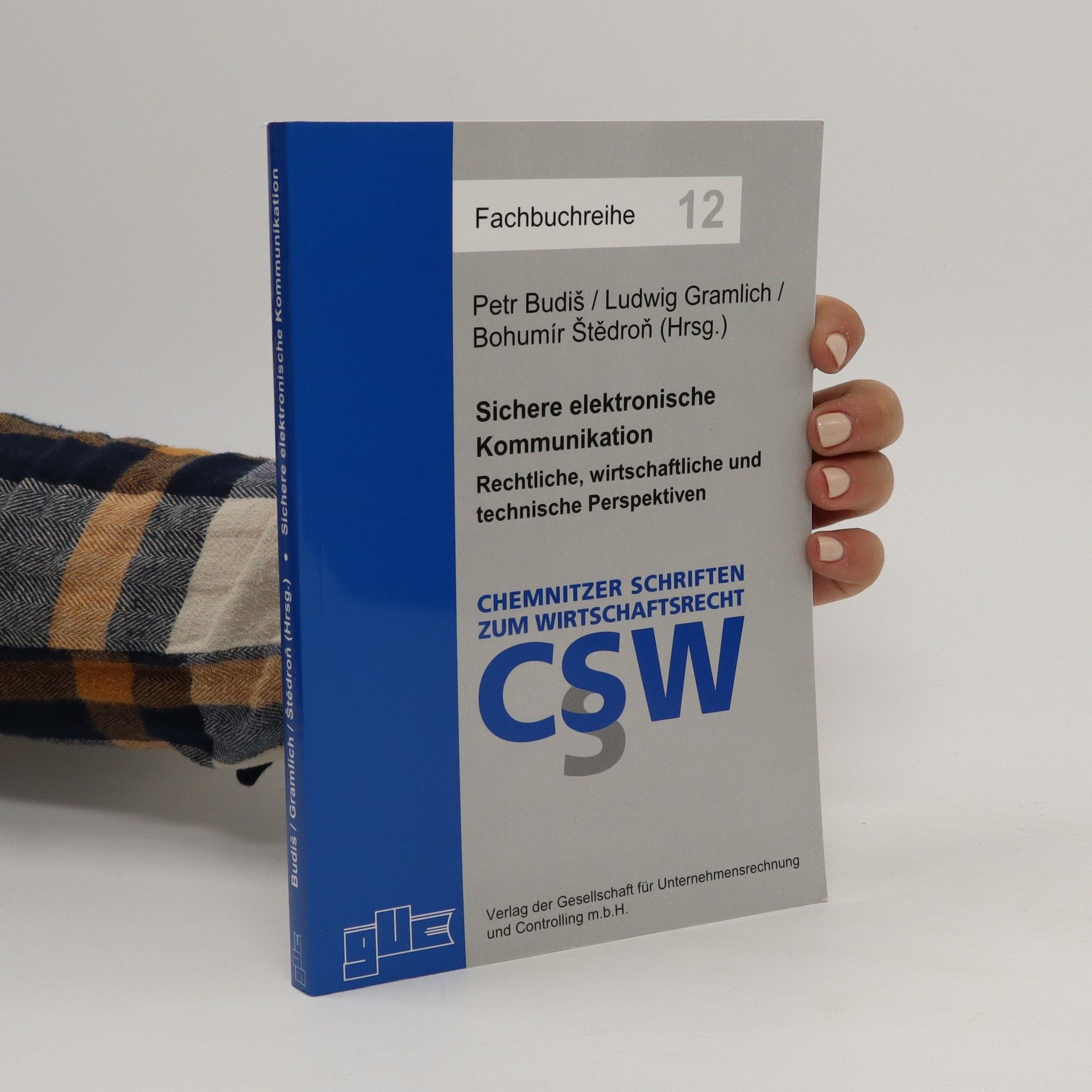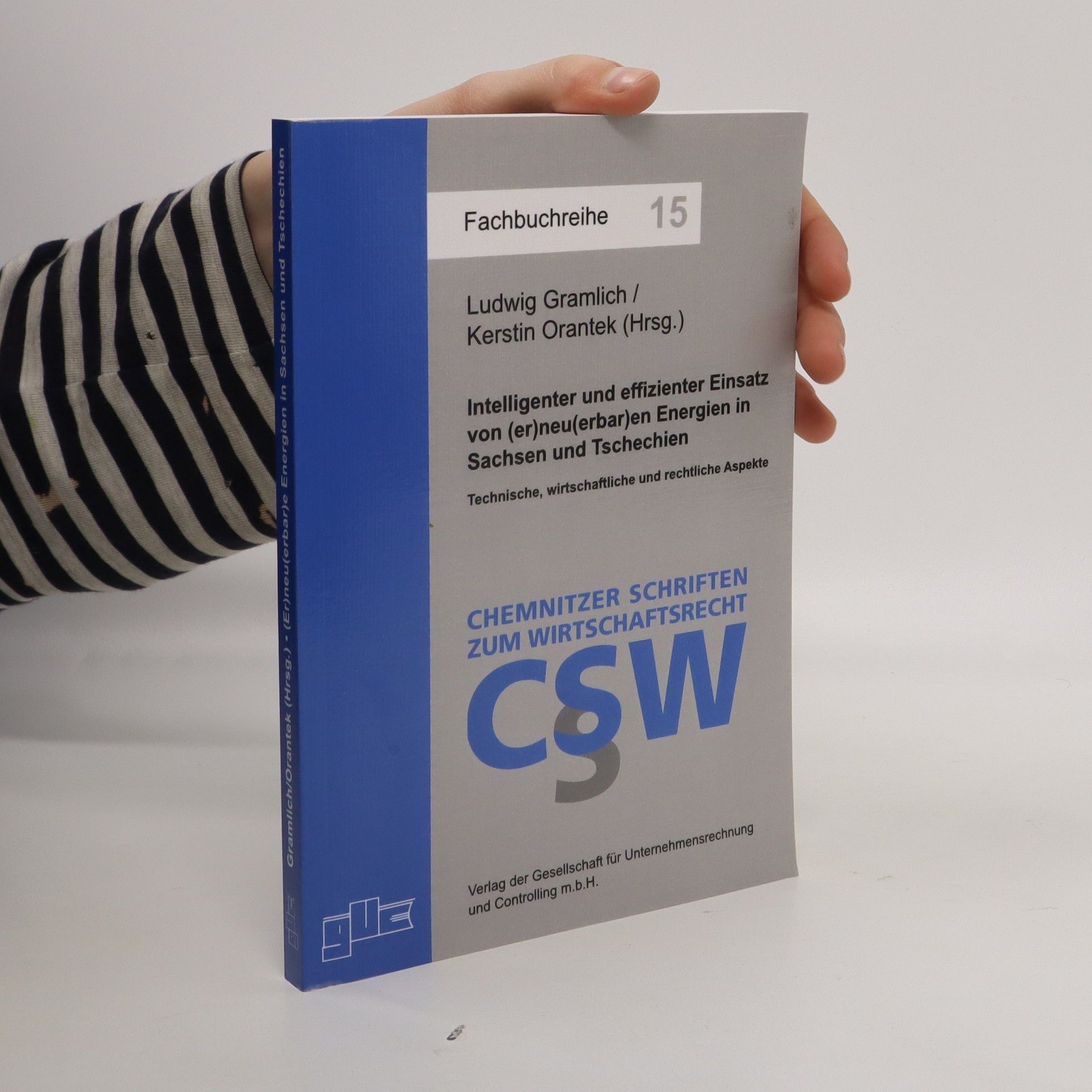Öffentliches Wirtschaftsrecht
- 252pagine
- 9 ore di lettura
Öffentliches Wirtschaftsrecht – schnell erfasst behandelt in einem Allgemeinen Teil zunächst die Dimensionen des Wirtschaftsrechts, Grundbegriffe, System und Akteure, sodann Fragen der nationalen, europäischen und internationalen Wirtschafts„verfassung“, anschließend die Organisation der Wirtschaftsverwaltung, deren Aufgaben und Instrumente, ferner Probleme staatlicher wirtschaftlicher Betätigung und als Querschnittsbereiche Datenschutz und Sanktionen. Der Besondere Teil befasst sich mit ausgewählten materiell-rechtlichen Problemen, wie dem Gewerbe-, dem Regulierungs- und dem Subventionsrecht. Fälle mit Lösungen dienen der exemplarischen Vertiefung von Schwerpunkten. Das Werk verbindet zudem das Sachverzeichnis mit einem Glossar und bereitet die einzelnen Kapitel durch Fragen vor, die am jeweiligen Ende (den Text ergänzend) beantwortet werden.