Die im vorliegenden Band versammelten Arbeiten französischer, italienischer, deutscher, holländischer und dänischer Forscher sind dieser frü hen Phase der europäischen Hexen Verfolgungen gewidmet: Sie vermitteln ein überaus plastisches Bild der Genese des spätmittelalterlich-frühneu-zeitlichen Hexenglaubens, und sie beleuchten die Etappen und Stationen seiner Verbreitung. Sie charakterisieren die ersten Theoretiker des jungen Hexen"wahns" und beschreiben die Opfer der ersten Prozesse. Und sie setzen sich kritisch mit dem aktuellen Interesse an Hexerei, Hexenwesen und Hexenverfolgung auseinander.
Andreas Blauert Libri
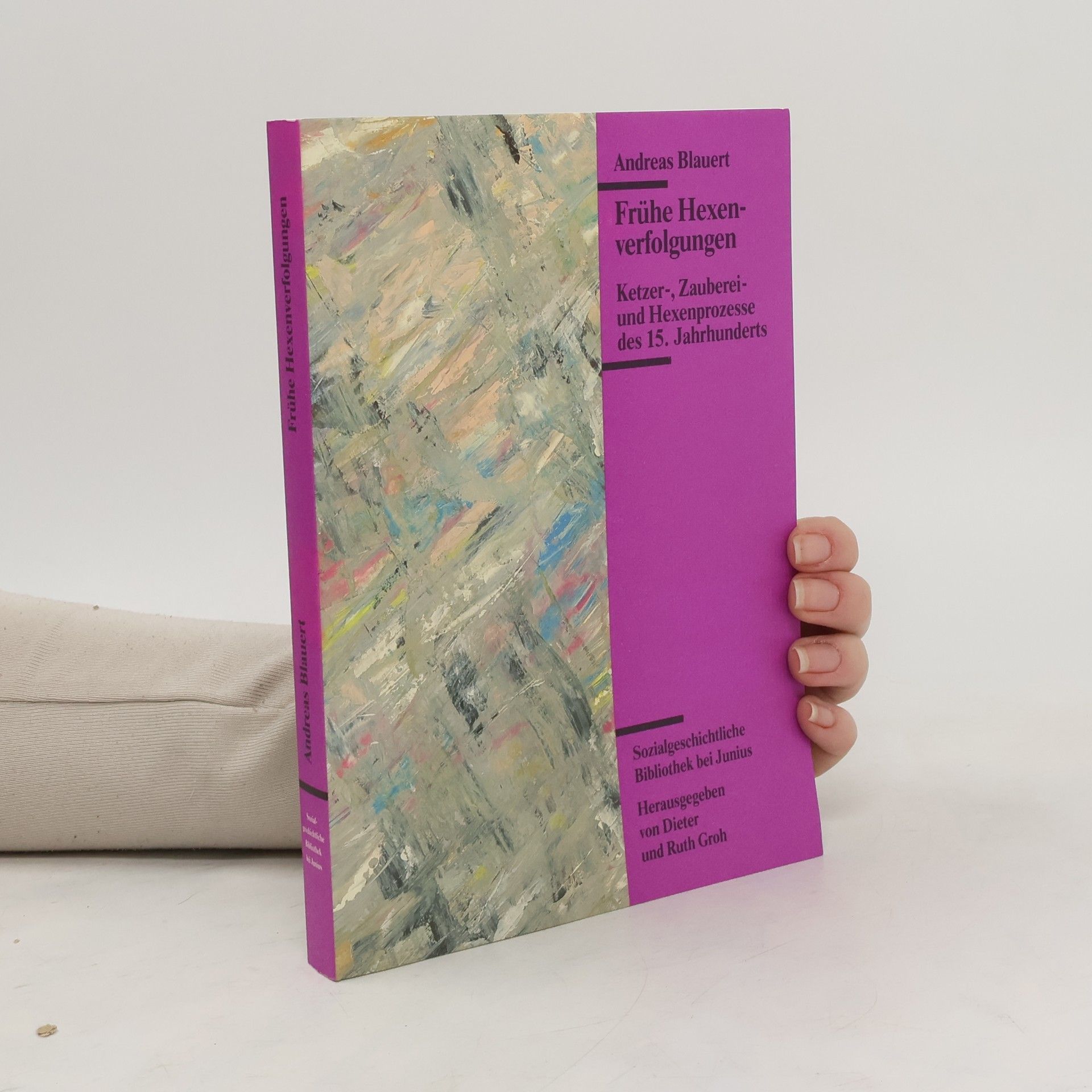
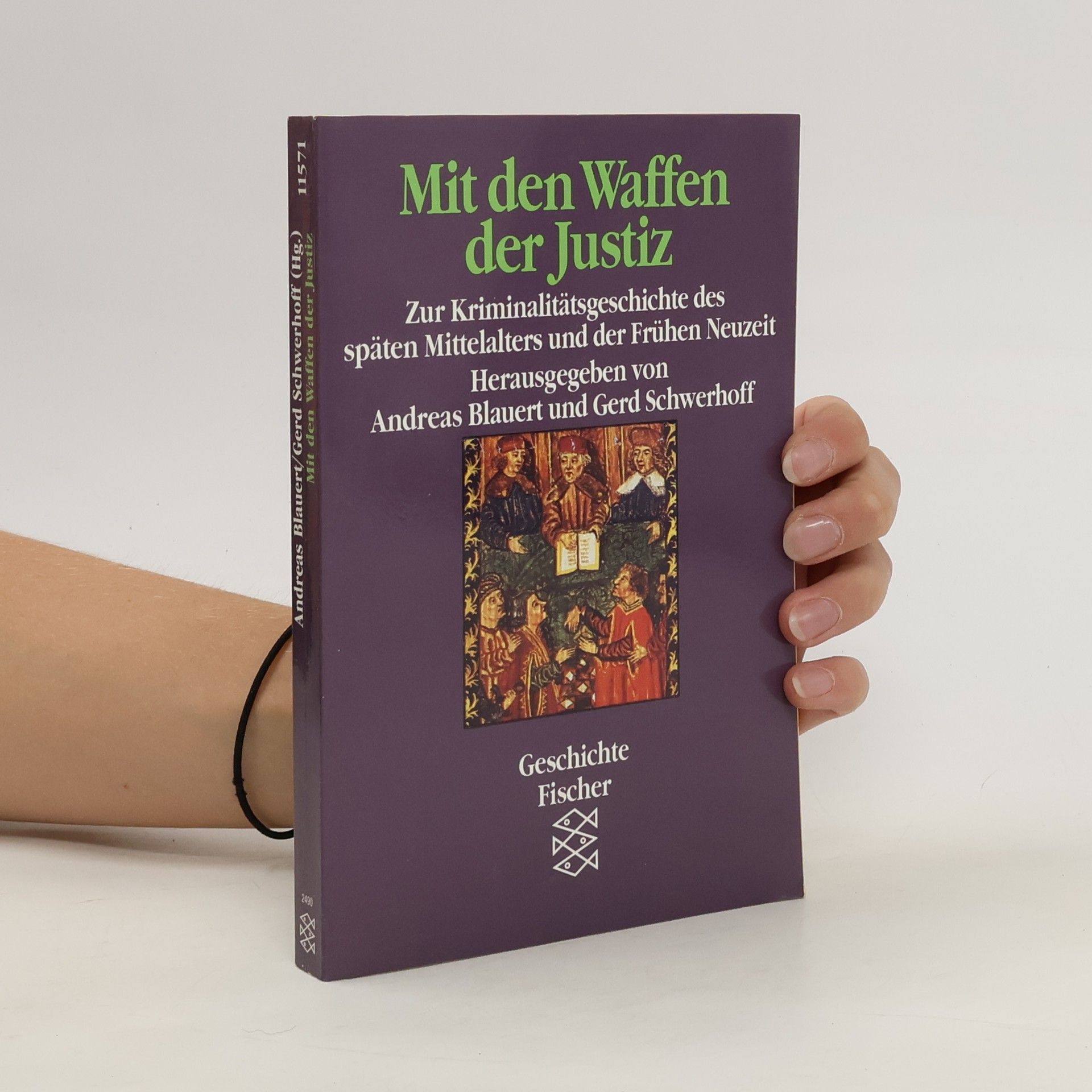

Mit den Waffen der Justiz
- 251pagine
- 9 ore di lettura
Hrsg. u. Beitr. von Blauert, Andreas ; Schwerhoff, Gerd Mit Beitr. u. a. von Dinges, Martin ; Lambrecht, Karen ; Roper, Lyndal 1 Abb. 251 S.
Diese Pionierstudie unterzieht die Anfänge der Hexenverfolgungen im 15. Jahrhundert in Form einer Regionalstudie einer kritischen, neue quellenerschließenden Neubetrachtung. Der Kern der Untersuchungsregion liegt im Dreieck der Schweizer Städte Luzern, Lausanne und Neuchâtel, die in einen weiten europäischen Kontext gestellt werden. Andreas Blauert beleuchtet dafür unter anderem die mit dem frühen Hexenglauben verwandten Konzepte, die ersten Hexenprozesse um 1430/40 oder die Mittlerfunktion des Basler Konzils 1431–1449 bei der Formulierung und Weitervermittlung des jungen Hexenglaubens. Die Abfassung des berühmt-berüchtigten Hexenhammers des Heinrich Institoris wird von ihm in den Zusammenhang einer ersten größeren Hexenprozesswelle der Jahre 1477–1486 gestellt. Mit der Zusammenführung traditioneller mediävistischer und neuerer sozialgeschichtlicher Forschungsansätze gelingen dem Autor so bahnbrechende, modellhafte Einsichten in die Entstehungsgeschichte des Hexenbegriffs und in die Geschichte der frühen Hexenprozesse in Europa.