Die Deutschen und Luther
- 235pagine
- 9 ore di lettura
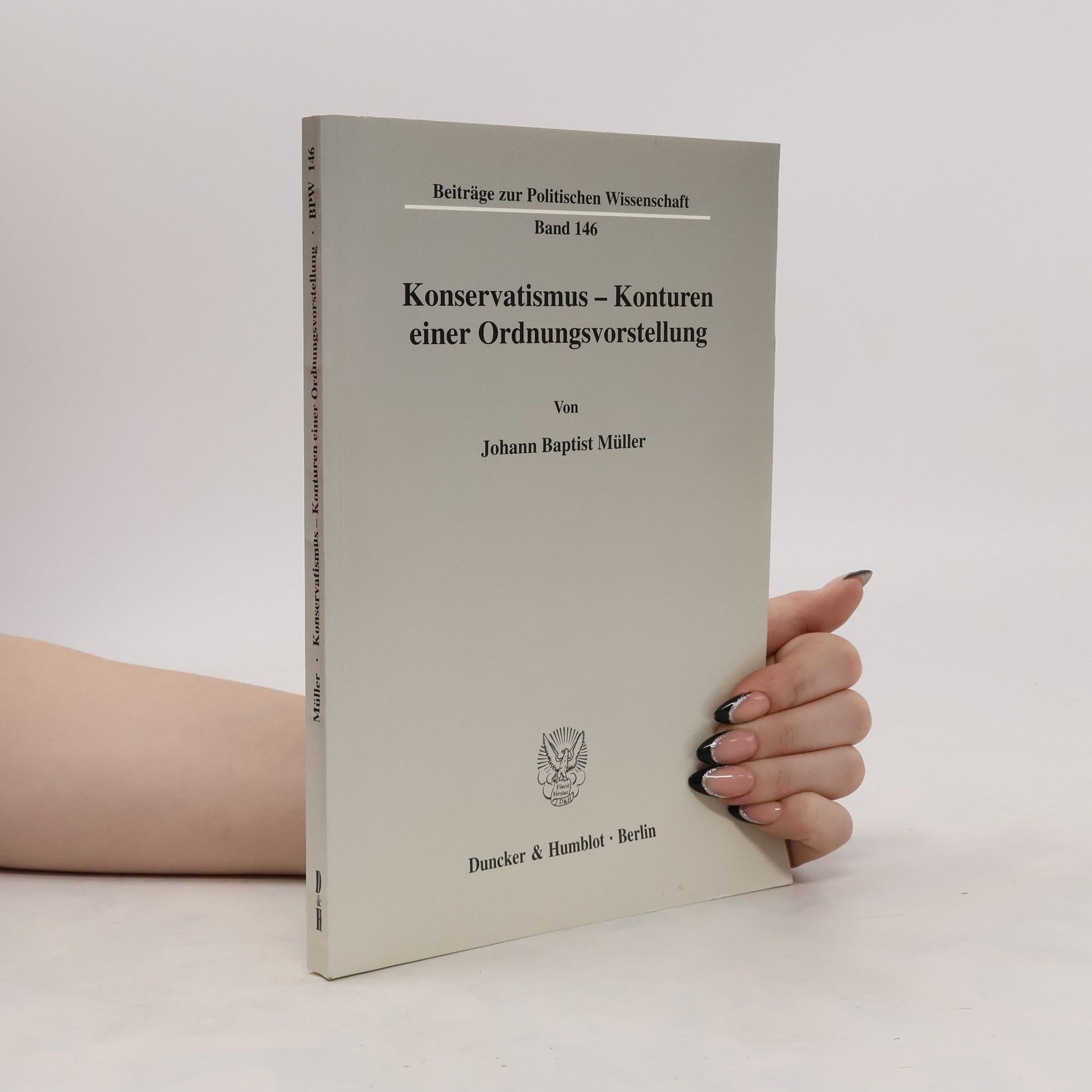

Diese Abhandlung präsentiert vorwiegend amerikanische, deutsche, englische und französische Autoren, die den Konservatismus als ebenso legitim betrachten wie Liberalismus und Sozialismus. Besonderes Augenmerk gilt dem Verständnis dieser Ideologien und der Frage, seit wann es einen konservativen Ideenkreis gibt. Es wird untersucht, ob dieser Ideenkreis auf gefühlsbetonten Überlegungen beruht oder einen vernunftorientierten Ansatz verfolgt. Die Notwendigkeit, sich rational mit den weltanschaulichen Gegnern auseinanderzusetzen, spricht für die letztere Sichtweise. Die Analyse des Konservatismus beleuchtet auch, ob das marktorientierte Denken von F. A. von Hayek in diese Denkrichtung passt. Die Mehrheit der Befürworter plädiert für eine gemeinwohlorientierte Intervention in das Bedürfnis-System. Johann Baptist Müller thematisiert die Zukunftsperspektiven des Konservatismus und gibt sowohl Pessimisten als auch Optimisten eine Stimme. Es wird gehofft, dass der Konservatismus künftig dem reformorientierten Edmund Burke folgt. T. S. Eliot warnt, dass dogmatische Fortschrittsfeindlichkeit zu Stillstand führt, während blinder Fortschritt ins Chaos mündet. Der Rückgriff auf Burke wird dem politischen Denken von Joseph de Maistre vorgezogen, dessen Ideen als gescheitert gelten, ebenso wie die Versuche seiner Anhänger, die Französische Revolution rückgängig zu machen.