Die Epigonen. Familienmemoiren in neun Büchern 1823 - 1835.
- 824pagine
- 29 ore di lettura
Hrsg. von Peter Hasubek, Nach der Erstausgabe von 1836. 823 Seiten, Dünndruck-Ausgabe.

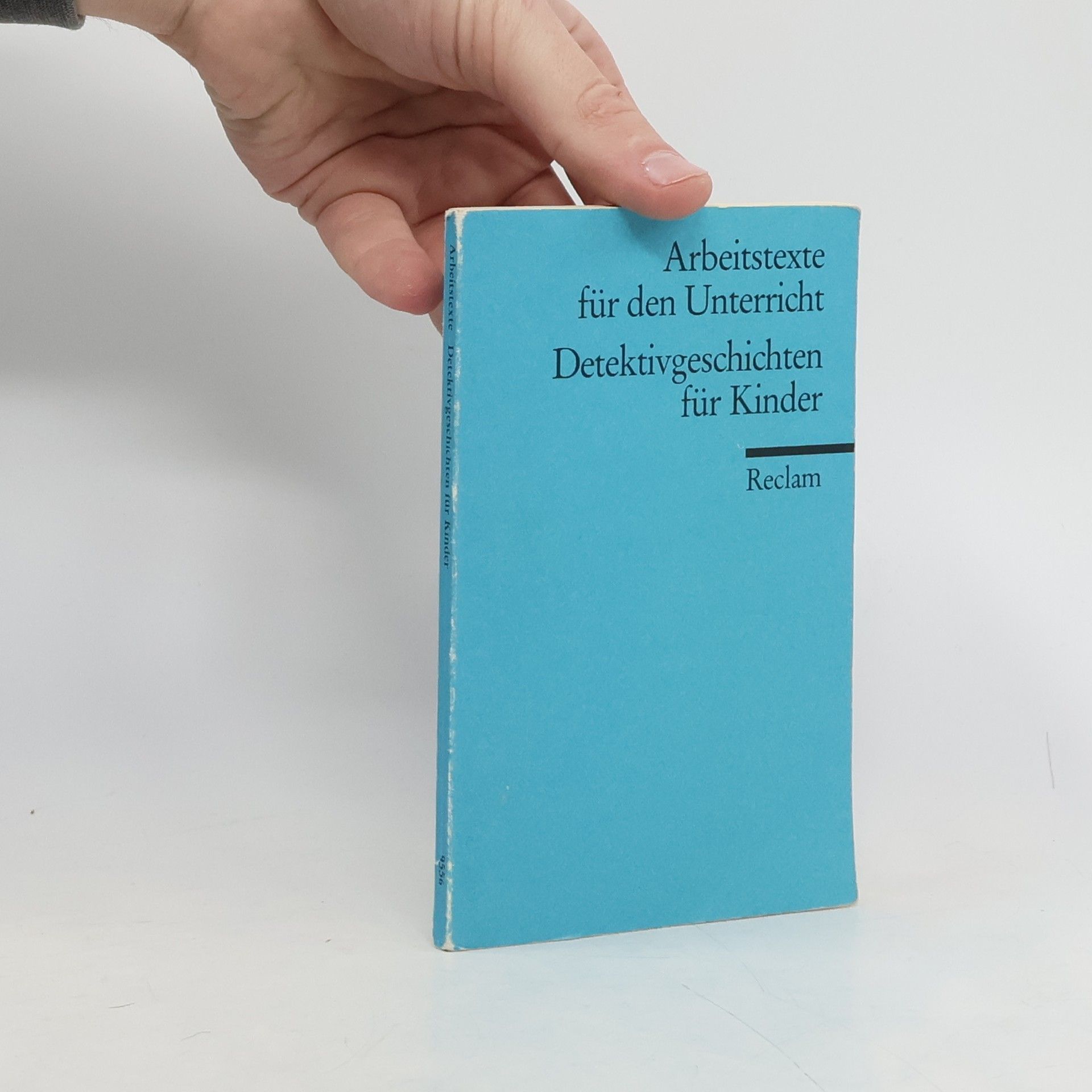
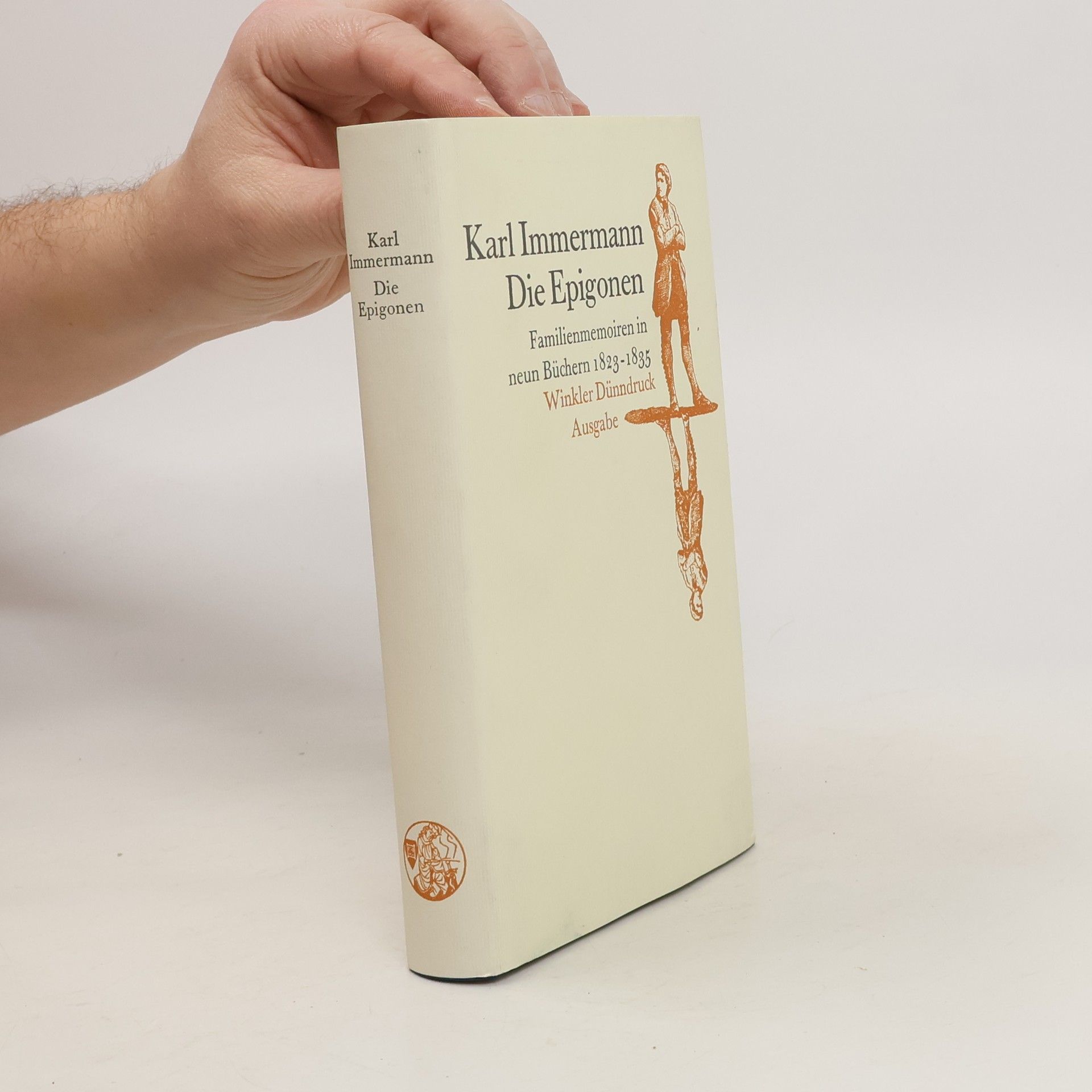
Hrsg. von Peter Hasubek, Nach der Erstausgabe von 1836. 823 Seiten, Dünndruck-Ausgabe.
Vor 100 Jahren, am 20. September 1998, starb Theodor Fontane. Im selben Jahr erschien sein letzter Roman „Der Stechlin". Dieses doppelte Jubiläum bildet den äußeren Anlaß für die vorliegende Studie. Die Untersuchung beschäftigt sich mit der Analyse des Gesprächs in Fontanes letztem Roman in der Absicht, die in der Wissenschaft seit langem gängigen Etiketten über Fontanes Kunst der Gesprächsgestaltung – Konversation, Plaudern, Causerie – durch genaue Beschreibungskriterien wissenschaftlich zu begründen. Im Mittelpunkt der Darstellung stehen Strukturen und Funktionen der Gespräche, wobei deren Grundstrukturen ebenso wie Sonderformen der Gesprächsgestaltung herausgearbeitet werden. Dabei werden u. a. die soziale Stellung der Redenden, ihre Altersstruktur, ihr Bekanntheitsgrad und die besondere Gesprächssituation berücksichtigt und die Einfügung der Gespräche in den Erzählbericht erörtert. Fontane war nicht der erste, der das Gespräch als Gestaltungsmöglichkeit im Roman favorisierte. Deshalb wird in einem besonderen Kapitel der Frage nachgegangen, welche Ausprägungen und welche Funktionen das Gespräch im 18. und 19. Jahrhundert besaß und welche Auswirkungen dies möglicherweise auf Fontanes Gesprächskunst hatte.