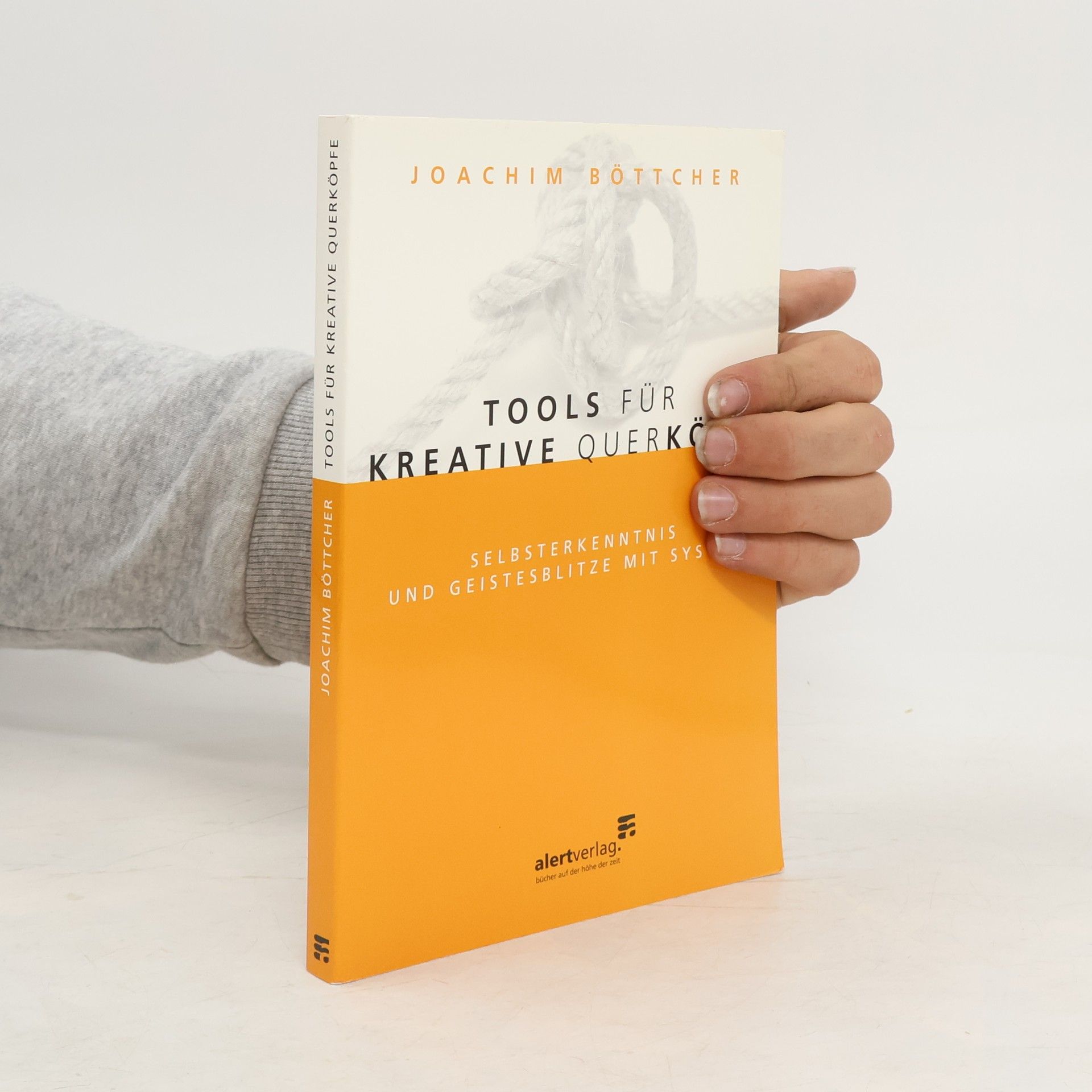Ferdinand von Sachsen-Coburg und Gotha 1861-1948
Ein Kosmopolit auf bulgarischen Thron
Prinz Ferdinand von Sachsen-Coburg und Gotha Herzog zu Sachsen (1861-1948) – der ab 1887 als Fürst, später dann als Zar von Bulgarien wirkte. Dessen gesamtes bemerkenswertes Leben von Geburt bis zum Tod ist es, welches in der Folge nachgezeichnet wird. Der Schwerpunkt liegt dabei auf seinem Privatleben, wie seinen persönlichen Eigenheiten und Liebhabereien, aber auch den politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leistungen. Im Rahmen des Wirkens von Ferdinand wird ebenfalls die große internationale Machtpolitik skizziert und deren Auswirkungen auf ihn und Bulgarien. Insbesondere handelt es sich dabei um die beiden Balkankriegen 1912/13 sowie dem Ausbruch und der Beteiligung Bulgariens am Ersten Weltkrieg 1915/18, dessen Verlauf letztlich Ferdinand zum Rücktritt zwang und zu einem Leben im Asyl in Deutschland.