Kants Ethik
- 120pagine
- 5 ore di lettura
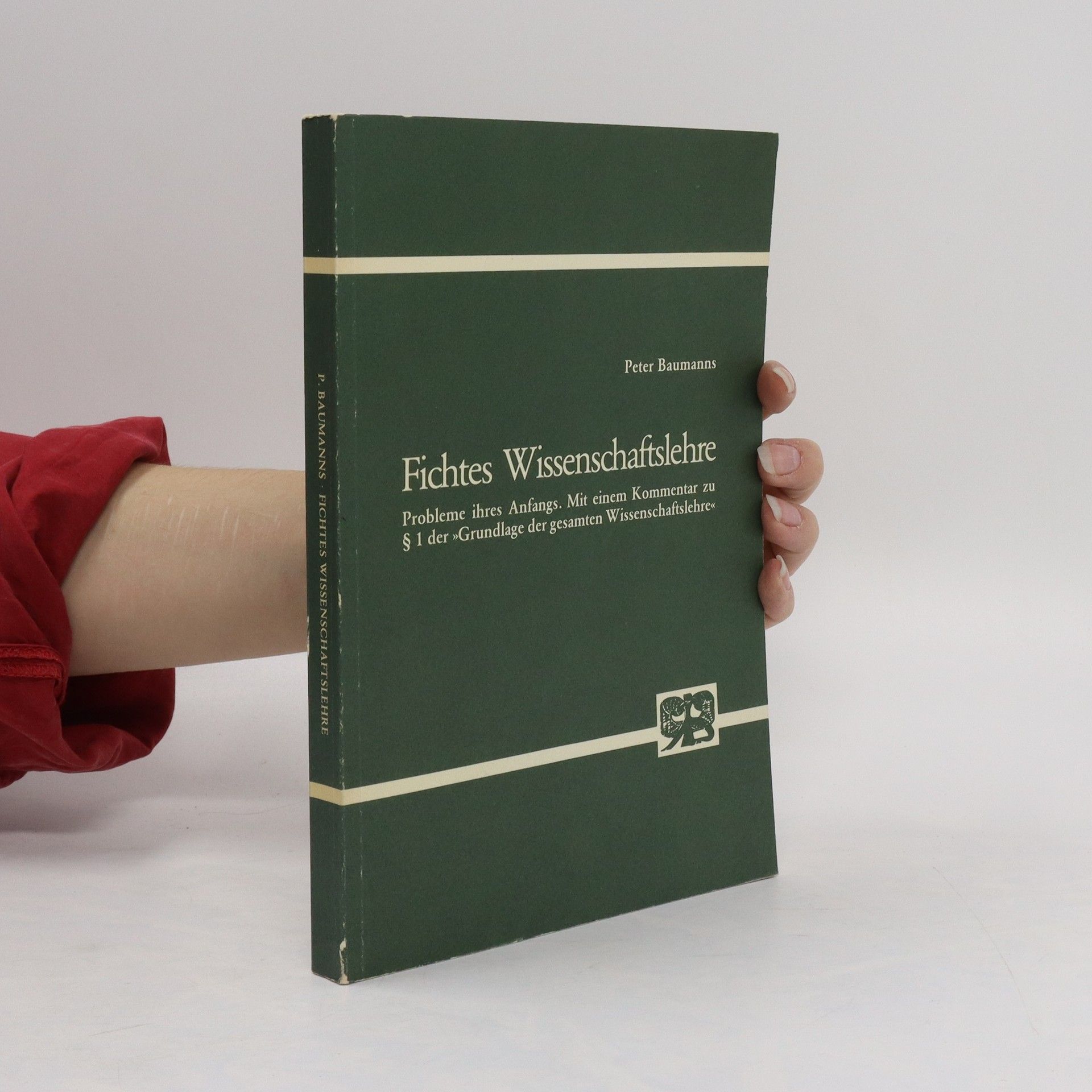


Schillers philosophische Schriften reflektieren die Analogie zwischen Seele und Staat. Er erkennt die Doppelnatur der Seele, die bei Platon als Gegensatz zwischen Vernunft und Begierde und bei Kant als Gegensatz zwischen praktischer Vernunft und egoistisch-altruistischer Sinnlichkeit erscheint. Platon beruft sich auf die Idee der Gerechtigkeit im Kontext des Guten, während Kant die Harmonie zwischen Intellekt und Sinnlichkeit, einschließlich ästhetischem Gemeinsinn und moralischem Gefühl, der metaphysischen Beziehung zwischen Subjekt und Objekt überlässt. Schiller entwickelt seine „Metaphysik des Schönen“ und interpretiert die Verbindung von Sinnlichkeit und Vernunft als „Freiheit in der Erscheinung“, gestützt auf Kants Konzept des subjektiven und objektiven Intelligiblen. Er nutzt Kants Terminologie des „Geistes in uns“ und des „großen Geistes der Natur“, ohne sich auf spekulative Identitätsphilosophie zu stützen. Dies ermöglicht eine konsistente Lesart, insbesondere hinsichtlich der Analogie zwischen dem „ästhetischen Zustand der Seele“ und dem „ästhetischen Staat“ sowie der „ästhetischen Erziehung des Menschen“. Schiller erweitert Kants Subjektsbegriff nicht um kulturhistorische Perspektiven, sondern bereichert ihn durch ästhetische Ausgestaltung.