Der Begriff der heiligen Schrift ist in unserer Tradition so geläufig, dass eher selten darüber nachgedacht wurde, durch welche Merkmale eine Schrift als heilig ausgezeichnet wird. Die griechischen Polisreligionen kannten keine heiligen Schriften, wie sie heute in den abrahamitischen Religionen verstanden werden. Orakelsprüche fielen in der Regel vieldeutig und widersprüchlich aus. Der Bedeutungszuwachs heiliger Schriften korrespondiert mit dem Übergang vom Opferkult zum Wortgottesdienst. Der Religionswissenschaftler Hartmut Zinser beschreibt erstmals ausführlicher diese Transformation und setzt sich mit dem dann nun wichtig gewordenen Phänomen der Kanonisierung heiliger Schriften auseinander. Er stellt die Frage nach der Möglichkeit der „Fälschung“ heiliger Schriften und zeigt, wie die Auslegung heiliger Schriften zu einer Rationalisierung beiträgt. Der Religionswissenschaftler Hartmut Zinser beschreibt erstmals ausführlicher diese Transformation. Er setzt sich mit dem nun wichtigen Phänomen der Kanonisierung heiliger Schriften auseinander, stellt die Frage nach der Möglichkeit der „Fälschung“ heiliger Schriften und zeigt, wie die Auslegung heiliger Schriften zu einer Rationalisierung beiträgt.
Hartmut Zinser Libri
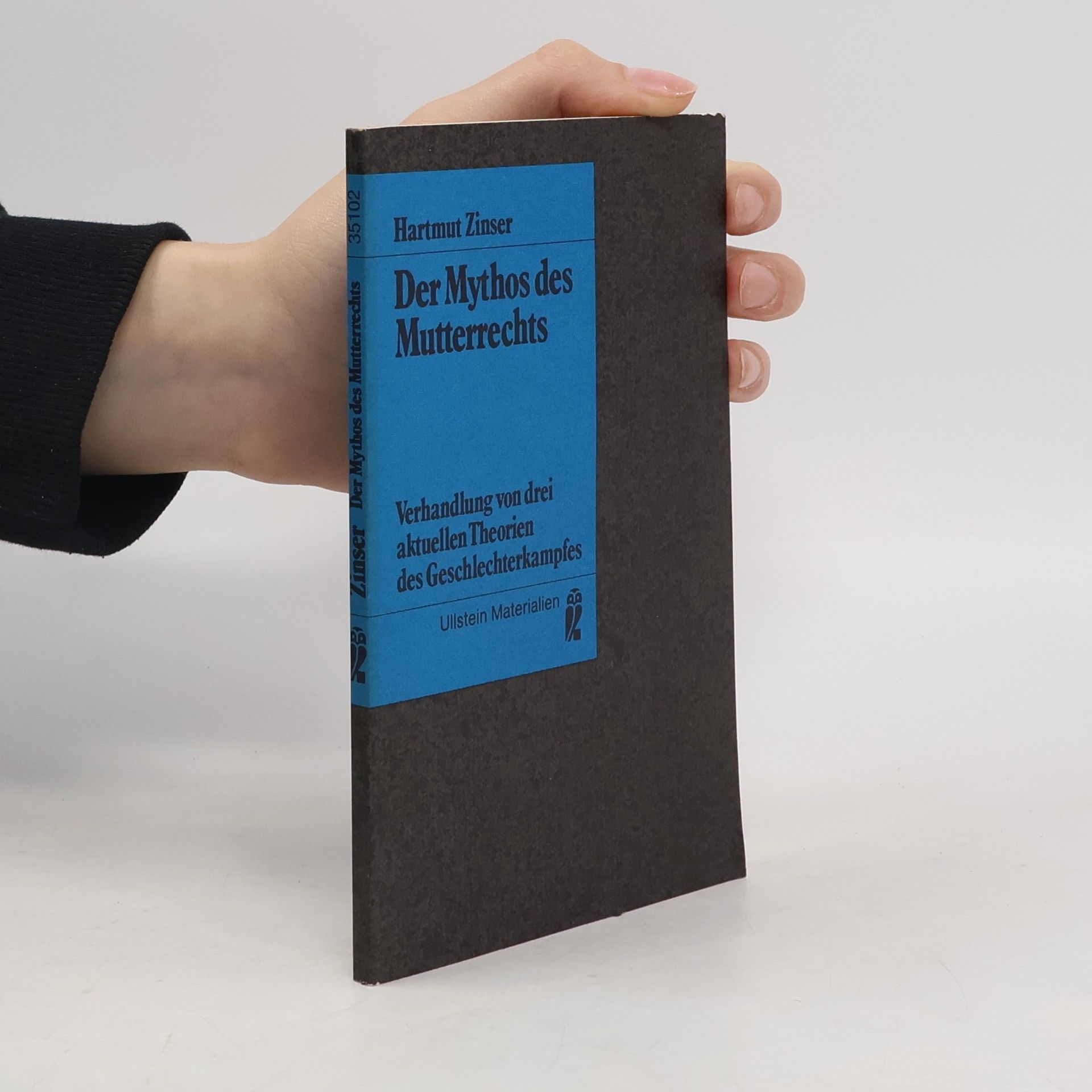


Die Menschheitsgeschichte weist unzählbar viele Religionen auf. Doch anders als vielen ihrer Gottheiten nachgesagt wird, sind Religionen nicht unsterblich. Religionen, entstehen, verschmelzen mit anderen, sie werden ausgerottet oder verlieren ihre Plausibilität und verschwinden, gehen unter. Das wissenschaftliches Interesse konzentriert sich meist auf die Entstehung von Religionen und vernachlässigt deren Untergang und Verschwinden. Der Religionswissenschaftler Hartmut Zinser betrachtet im vorliegenden Band diesen Prozess erstmals genauer und untersucht einige der damit zusammenhängenden zentralen Fragen: Welche Rolle spielt die Konkurrenz mit anderen Religionen? Wie wirken sich religiöse Reformbewegungen aus? Welche Veränderungen sind auf Migration zurückzuführen? Wie unterscheidet sich der Untergang einer Religion von einem „Absterben“, wie es von manchen Säkularisierungstheorien prognostiziert wird? Führt Religionsfreiheit zu einer Stabilisierung von Religionen oder begünstigt sie deren Wandel?