Manching
Die Keltenstadt




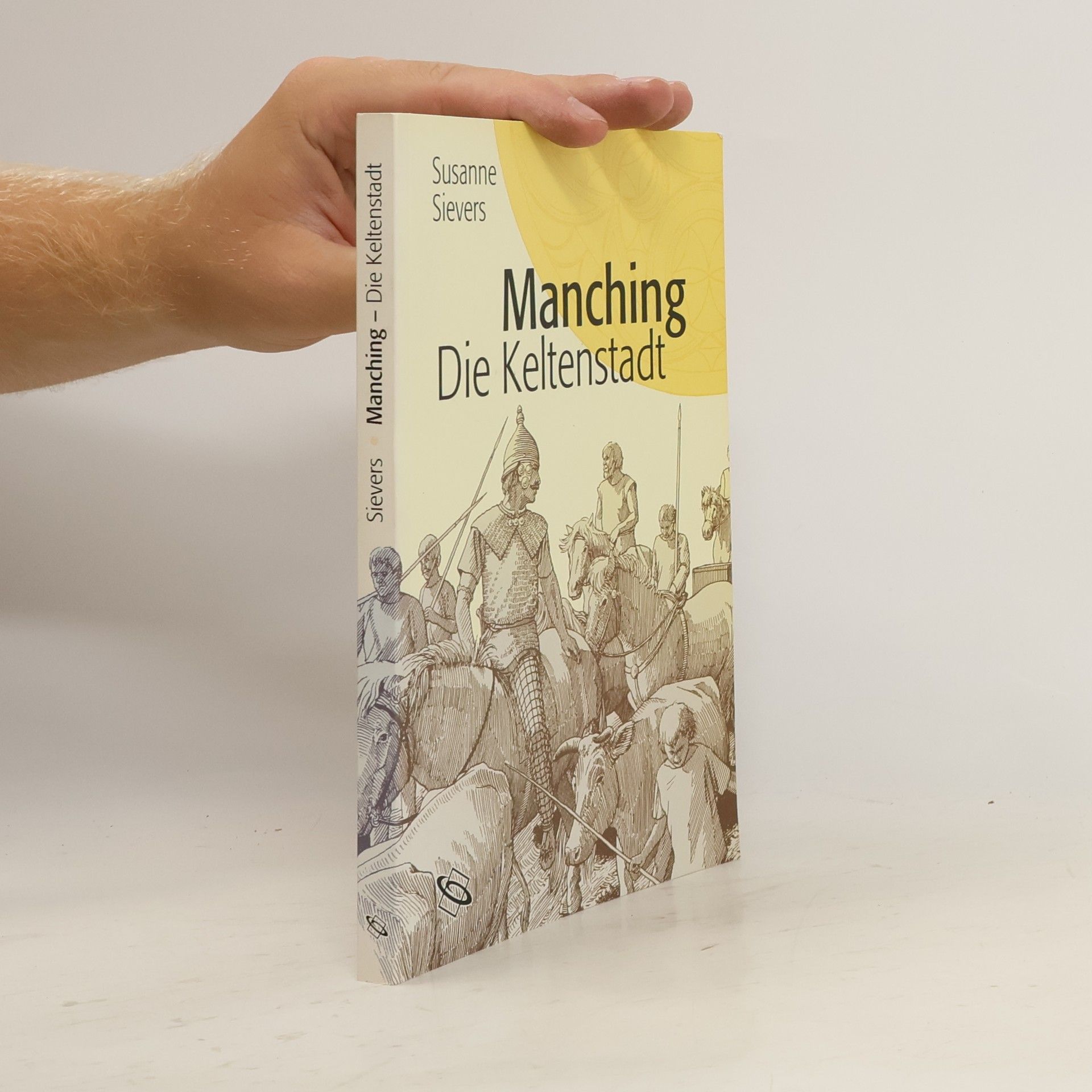
Die Keltenstadt
Feste sind Teil unseres taglichen Lebens. Selten machen wir uns klar, in welch langer Tradition derartige Einrichtungen stehen. Mit einem Blick auf die Eisenzeit werden einzelne Bestandteile von Festen zuruckverfolgt, aber auch deren Besonderheiten hervorgehoben. Grundlage fur die Rekonstruktion keltischer Feste sind neben schriftlichen Quellen zum einen Trank- und Speisebeigaben in reichen Grabern, zum anderen Befunde aus Siedlungen und Heiligtumern, in denen sich grosse Mengen an Geschirr und Tierknochen fanden. Zunehmend spielte der Import von Wein aus dem mediterranen Raum eine Rolle. Eine breite Oberschicht nutzte kollektive Feste, um ihre Herrschaft zu sichern und um Abhangigkeiten zu schaffen bzw. zu festigen. Daneben wird durchgehend eine Verbindung mit rituell-religiosen Handlungen sichtbar.
Die Waffen aus dem Oppidum von Manching haben seit den Ausgrabungen in den 50er Jahren großes Interesse geweckt. Ursprünglich wurden sie als Beweis für eine Eroberung durch die Römer im Jahr 15 v. Chr. angesehen. Nach intensiven Diskussionen wurde jedoch klar, dass das Ende des Oppidums deutlich vor der römischen Eroberung Süddeutschlands lag. Die Mehrheit der Waffen stammt nicht aus dem 1., sondern aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. Die Analyse der etwa 800 Waffen zeigt, dass ihre große Zahl nicht mit einer einzigen Theorie erklärt werden kann. Stattdessen wird die Waffenanzahl mit einer Krisensituation am Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. in Verbindung gebracht. Neben frühen Deponierungen in der Nähe eines Heiligtums gibt es Verlustfunde und Waffenfragmente, die auf handwerkliche Nutzung oder Recycling in einer späteren Phase der Siedlung hindeuten. Ein besonderer Fokus liegt auf den Funden vom Leisenhartfeld und dem zentralen Tempelchen. Erstmals werden die verstreuten Funde umfassend abgebildet und ihre Hintergründe analysiert. Die Interpretationen basieren auf einer genauen Analyse der Auffindungsbedingungen, Datierungsmöglichkeiten und typologischen Beobachtungen, sowie einem Vergleich mit Waffen aus anderen zeitgenössischen Siedlungen Europas. Die Waffen aus Manching ermöglichen eine tiefere Rekonstruktion der Siedlungsgeschichte von ihren Anfängen bis zu ihrem Ende, ergänzt durch einen Katalog und eine Konkordanz.
'ein umfassender Eindruck in sämtliche Lebensbereiche dieser frühesten Stadt in Süddeutschland.' Pforzheimer Zeitung