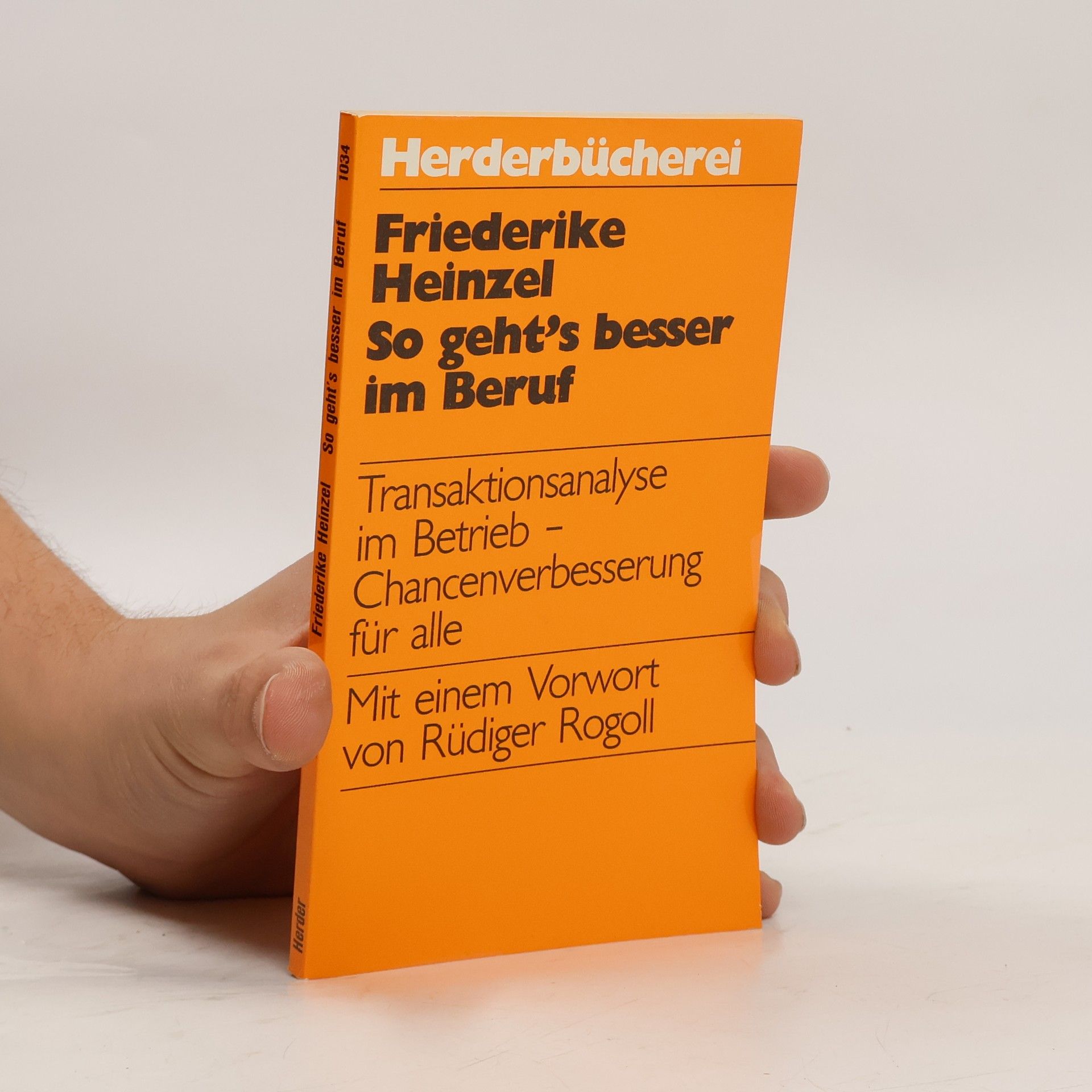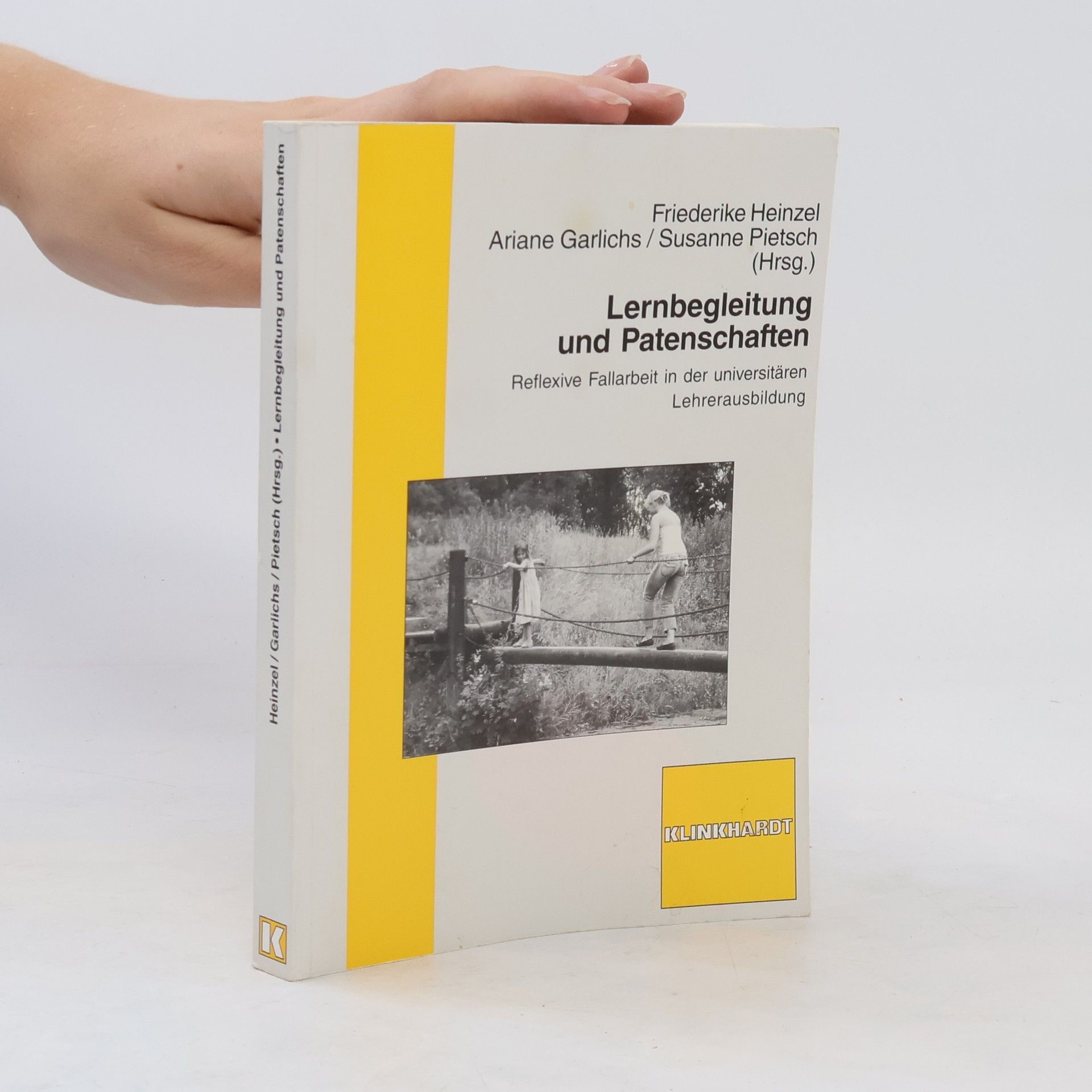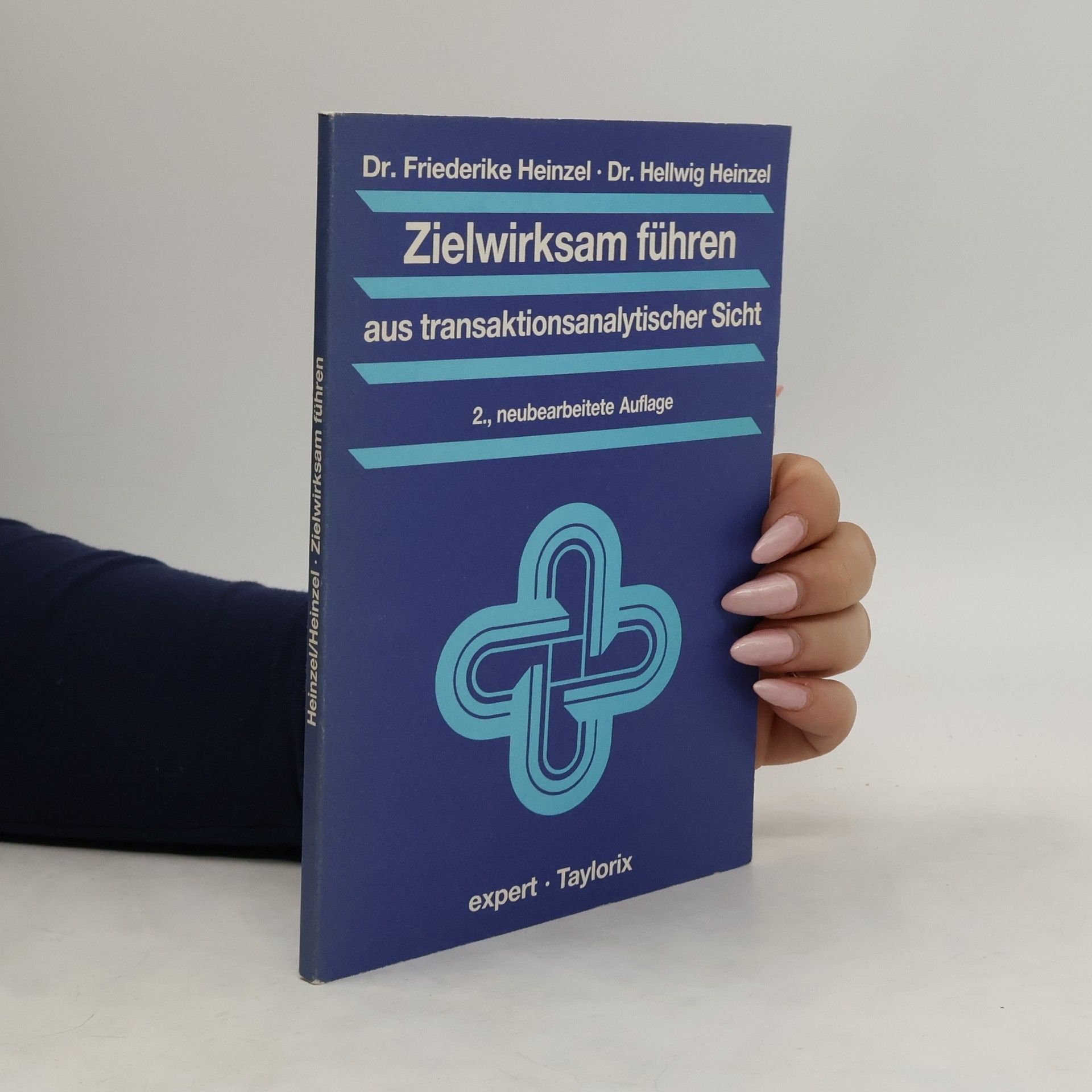Der Ruf nach Verbesserung der Schulqualität und praxisorientierter Lehrerausbildung wird immer lauter. Dieser Band bietet Einblicke in verschiedene Hochschulprojekte, die bereits erfolgreich umgesetzt werden und jeweils ein eigenes Profil entwickelt haben. Auf pragmatische Weise entsteht ein Fundus an Anregungen, der helfen kann, eine anspruchsvolle Ausbildung zu konkretisieren, die Theorie und Praxis verbindet und selbstkritisch ist. Die Projekte stellen das Kind und dessen Lebens- und Lernperspektiven in den Mittelpunkt. Studierende begleiten Kinder unterstützend und forschend, erleben und reflektieren Schule „von unten“ in Identifikation mit den Kindern. Diese Zentrierung ermöglicht es ihnen, Kindheit und Schule neu wahrzunehmen. Trotz der Unterschiede in den Projekten haben sich gemeinsame Regeln herauskristallisiert: langfristige Bindung an Aufgaben und Gruppen, strikte Verbindlichkeit bei Terminen, Eigenverantwortung in der praktischen Arbeit und Wahrung von Vertraulichkeit gegenüber den Kindern. Die Studierenden entwickeln oft eine starke Verbundenheit zu ihren Projektgruppen, die über das Studium hinaus bestehen bleibt und in der späteren Ausbildungs- und Berufssituation hilfreich ist. Neben den Projektberichten umfasst der Band auch einen Teil zu Fragen der zeitgemäßen Lehrerausbildung, einschließlich Theorie, Forschung und Fortbildung.
Friederike Heinzel Ordine dei libri
4 aprile 1962