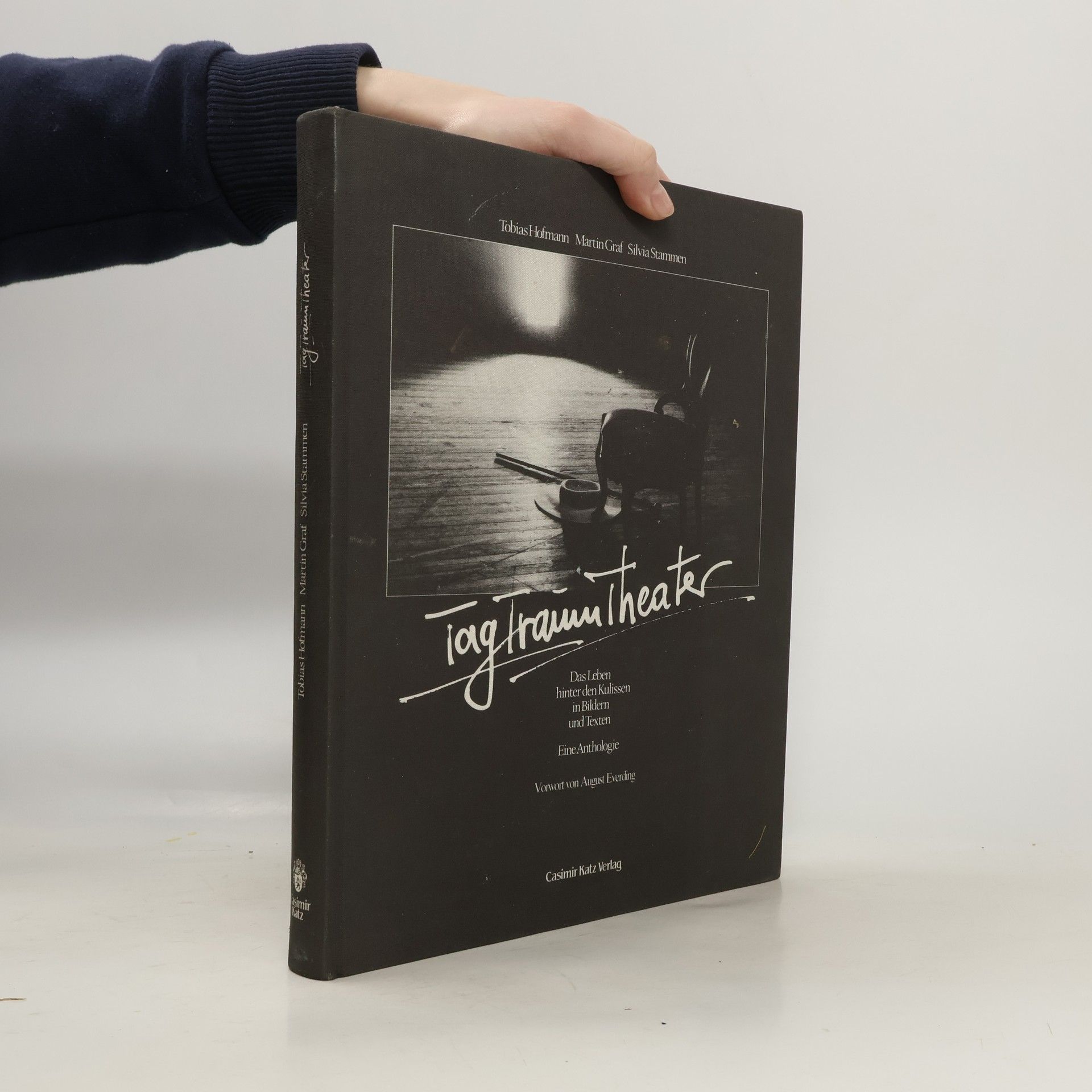Das Kirchenamt des Pastoralreferenten
Eine kanonistische Studie zu den Rahmenstatuten der DBK von 2011
"2011 wurden die Rahmenstatuten für Pastoral- und Gemeindereferenten durch die Deutsche Bischofskonferenz nach vorheriger Überarbeitung neu herausgegeben. Erstmals wurde den Statuten eine Theologische Präambel vorangestellt. Darin sollte die theologische Grundlage dieser pastoralen Berufe für sogenannte Laien dargestellt werden. Aus den relevanten Dokumenten des II. Vatikanischen Konzils, vor allem der Kirchenkonstitution Lumen Gentium, sowie aus den korrespondierenden Beschlüssen der Würzburger Synode und den universalkirchlichen Vorgaben des CIC/1983 lässt sich das Berufsprofil der Pastoralreferentinnen und -referenten theologisch und kirchenrechtlich ableiten. Sowohl die genannten Quellen als auch die Präambel der Rahmenstatuten lassen erkennen, dass die Entwicklung der Beschreibung eines solchen Berufsprofils keinesfalls abgeschlossen ist. Das Berufsbild der Pastoralreferenten ist nicht statisch, sondern in seiner Dynamik immer auch an die Entwicklungen der kirchlichen Wirklichkeit anzupassen. Das universalkirchliche Recht bietet dabei durchaus Chancen und hilfreiche Rahmensetzungen – auch wenn der Gesetzgeber diese pastorale Berufsgruppe nicht explizit erwähnt – die Rechtssicherheit gewähren und charismenorientierte Zukunftsorientiertheit ermöglichen." -- Page 4 of cover