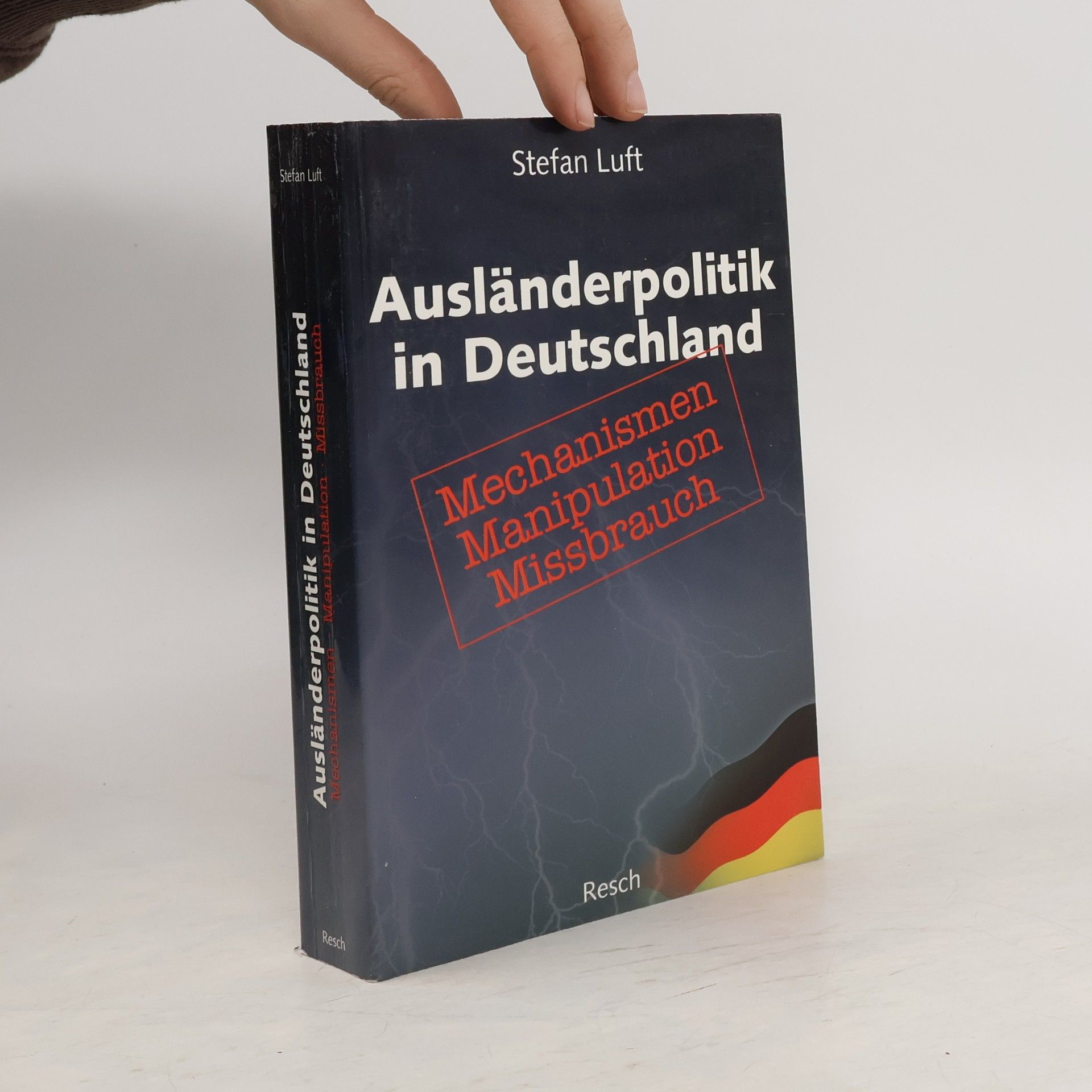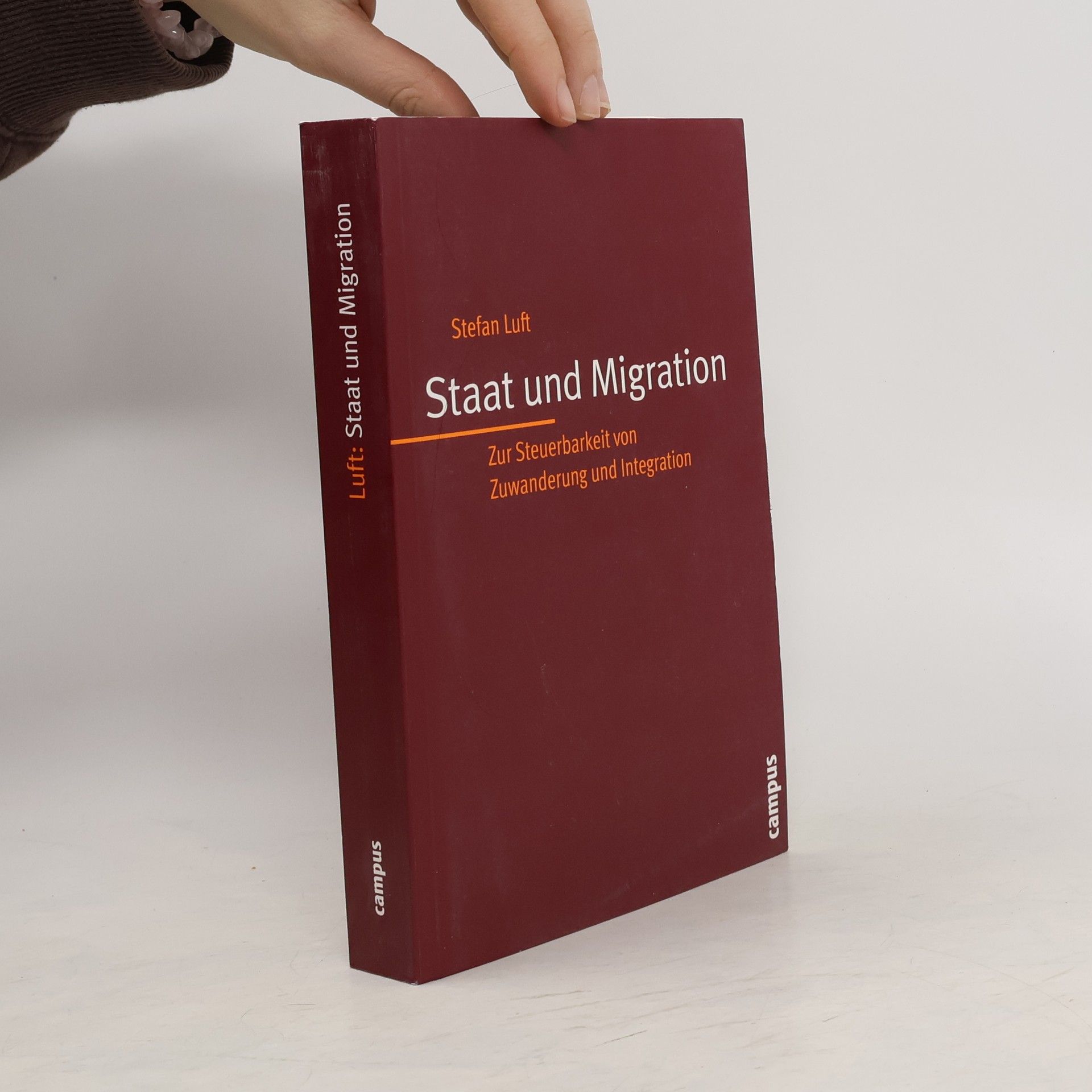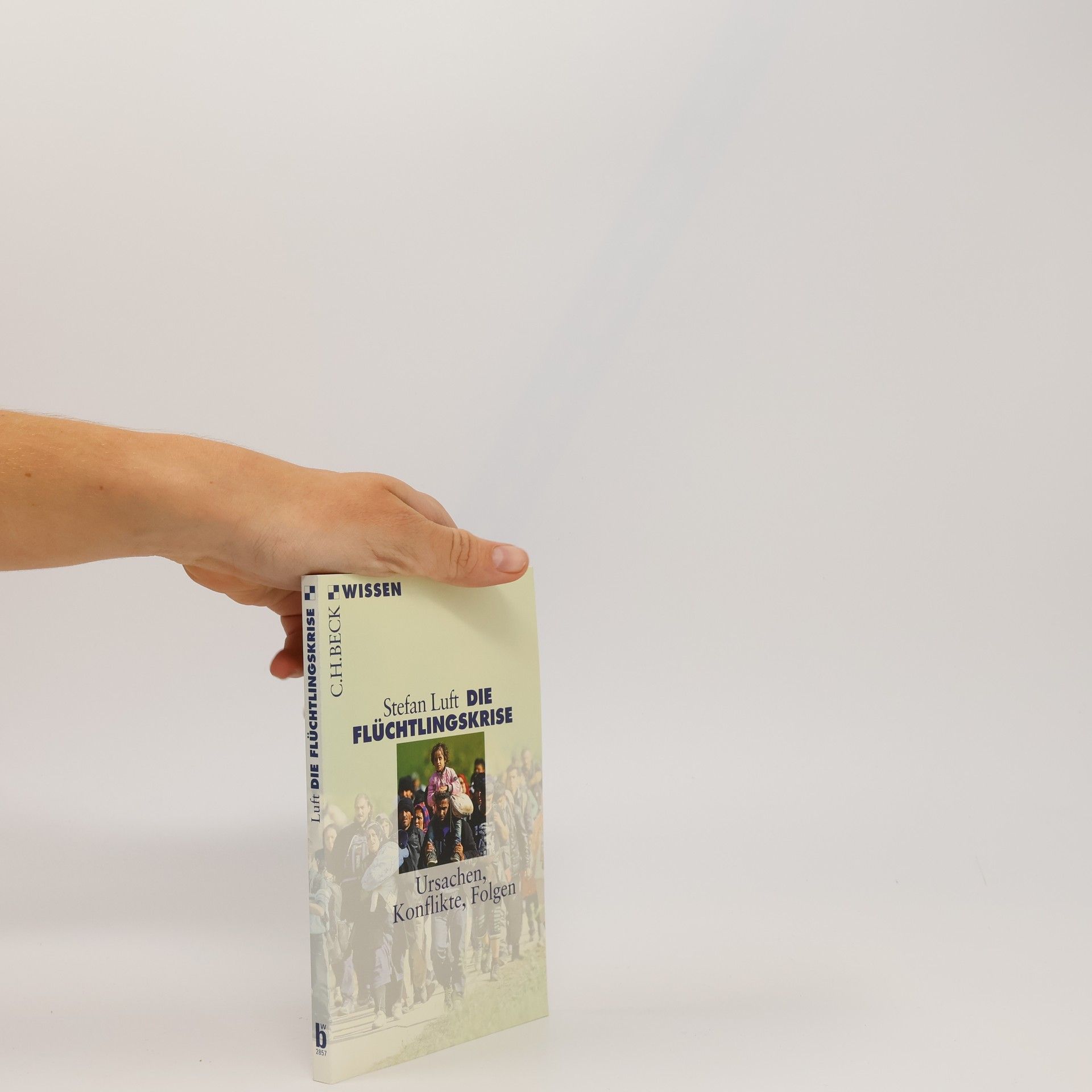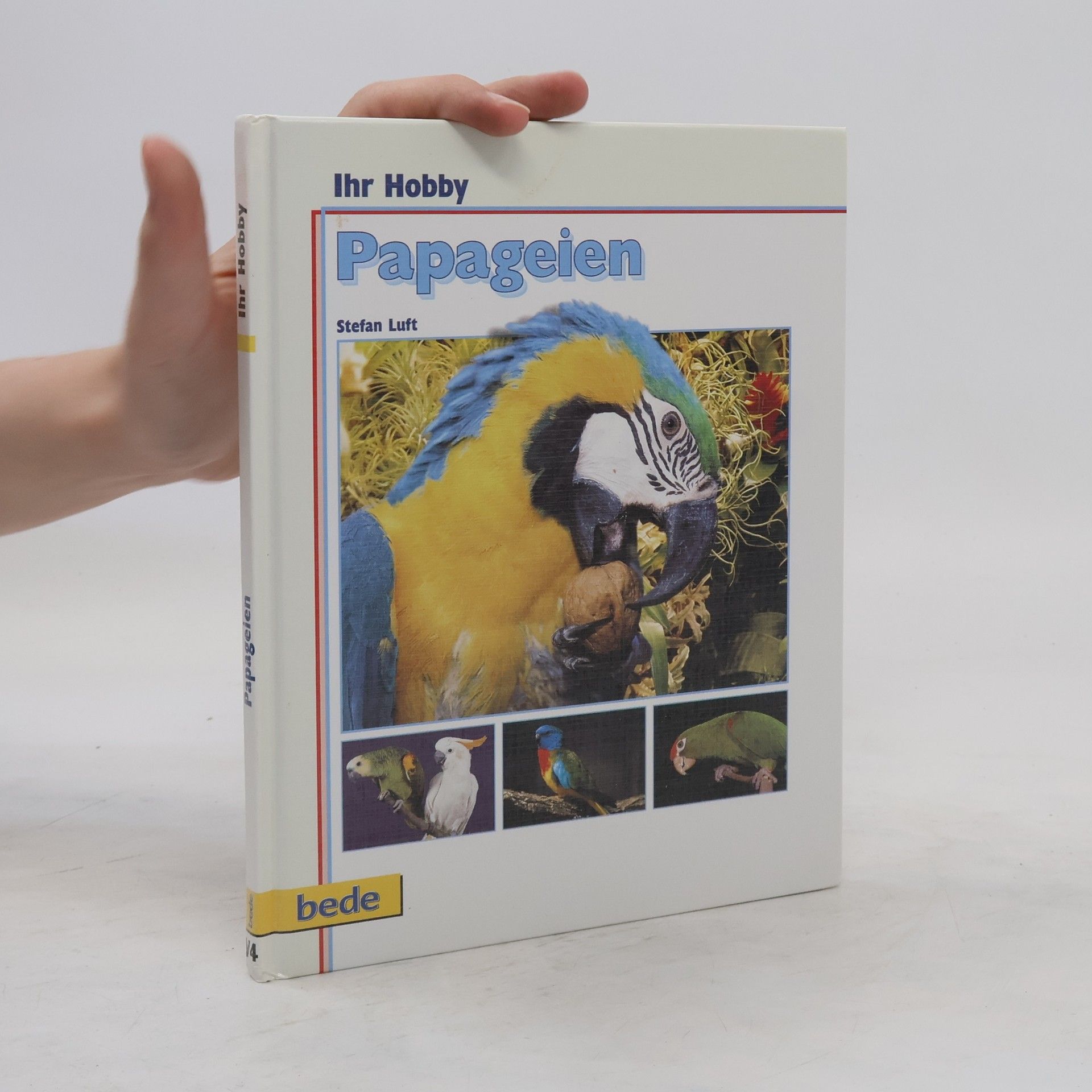Abschied von Multikulti
- 477pagine
- 17 ore di lettura
Seit den 1970er Jahren haben sich in vielen deutschen Städten „ethnische Kolonien“ gebildet, die aus der Anwerbung von „Gastarbeitern“ hervorgingen. Diese Kolonien erwiesen sich nicht als vorübergehende Stationen, sondern als Sackgassen, in denen Zuwanderer isoliert lebten und kaum Anreize hatten, die deutsche Sprache zu erlernen. Häufig führte schulisches Scheitern zu Arbeitslosigkeit, Sozialhilfeabhängigkeit und Kriminalität. Die deutsche Ausländerpolitik der 70er und 80er Jahre setzte auf die Bewahrung der „kulturellen Identität“, was die desintegrierenden Effekte der ethnischen Kolonien verstärkte. Trotz milliardenschwerer Sprach- und Integrationsangebote blieben die gewünschten Erfolge aus, während das Multikulturalismus-Konzept Abgrenzung und Isolation förderte. Die drängenden Fragen sind: Wie kann die schulische und berufliche Perspektivlosigkeit der Nachkommen der Gastarbeiter bekämpft werden? Was muss die deutsche Politik tun, um Generationen vor dem Rand zu bewahren und gewalttätige Ausbrüche zu verhindern? Wie können ethnische Kolonien in Parallelgesellschaften umgewandelt oder deren Entstehung verhindert werden? In seinem neuen Buch bietet der Autor einen realistischen Blick auf die Integrationspolitik und plädiert dafür, dass Integration eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Zuwanderer müssen ebenfalls Integrationsleistungen erbringen, während die Zuwanderung effektiv gesteuert werden muss. Angesichts der de