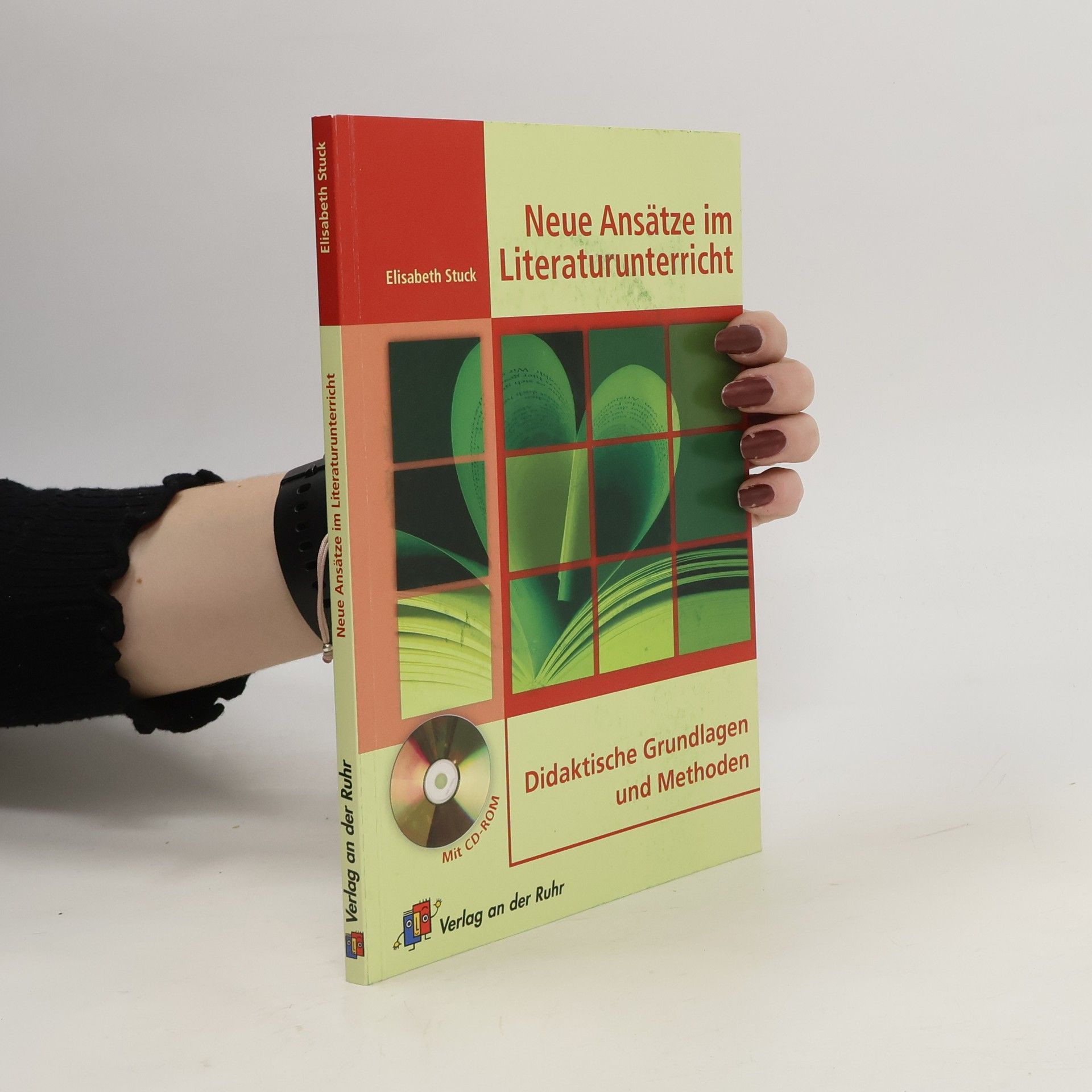Neue Ansätze im Literaturunterricht
- 129pagine
- 5 ore di lettura
Literatur ist lebendig, abwechslungsreich, vielschichtig. Genauso sollten auch die Methoden sein, mit denen Schülern ein Zugang zur Literatur eröffnet wird. Diese Einführung in die Literaturdidaktik zeigt, wie neue Wege der Literaturvermittlung aussehen können. Dabei sind Praxis und Theorie des literarischen Lehrens und Lernens eng miteinander verzahnt. Ergebnisse der Lerntheorie und Entwicklungspsychologie bilden das Fundament, auf dem die didaktischen Prinzipien eines handlungs- und schülerorientierten Literaturunterrichts dargestellt sind. Praktische Beispiele veranschaulichen die Methoden. Die Schüler arbeiten produktiv und kreativ mit den Texten, indem sie z. B. Rollenbiografi en verfassen, eine Vorgeschichte schreiben, Auszüge vertonen oder Beziehungen zwischen Figuren durch Standbilder darstellen. Mit Tipps und Checklisten die zeigen, wie die vorgestellten Methoden im Unterricht umgesetzt werden können.