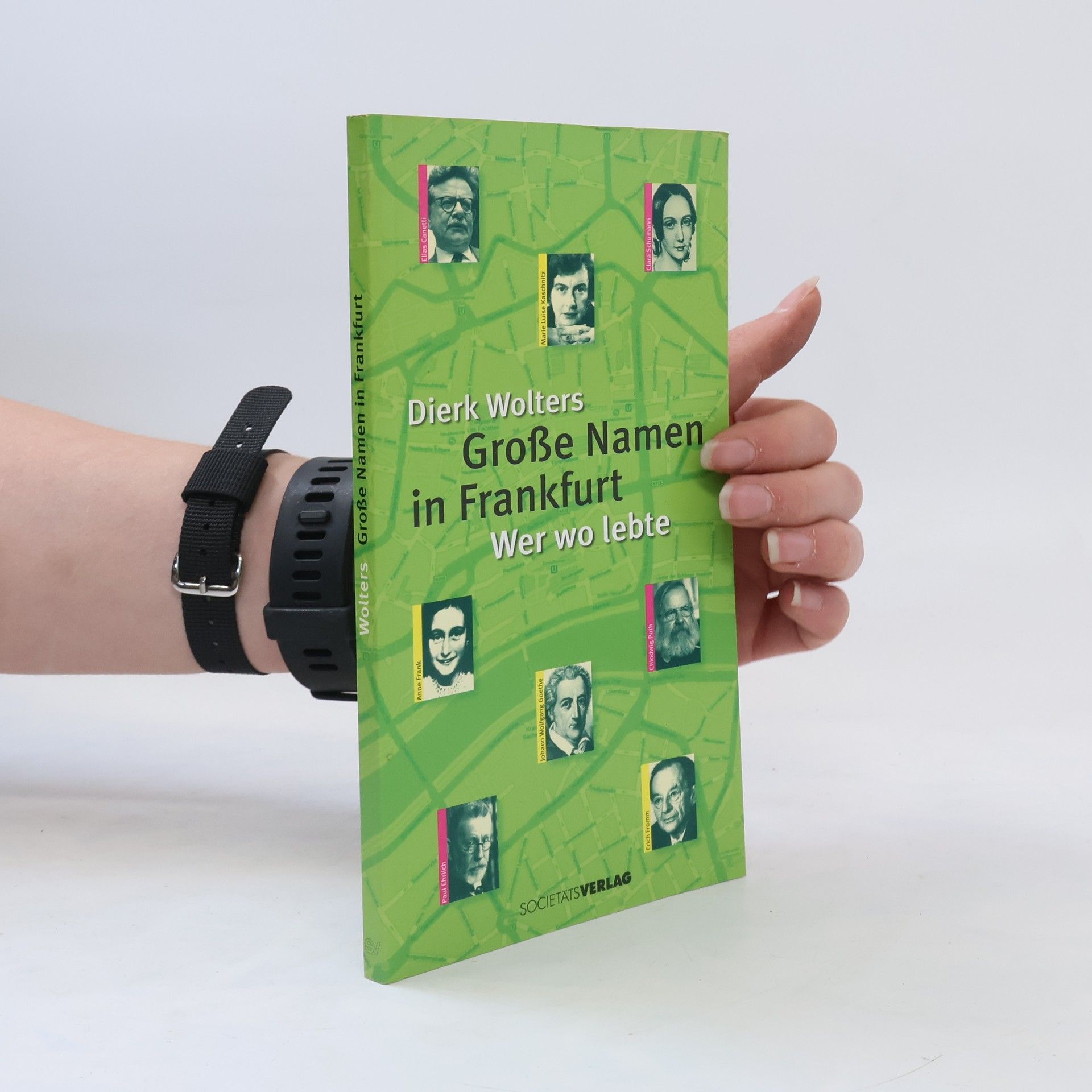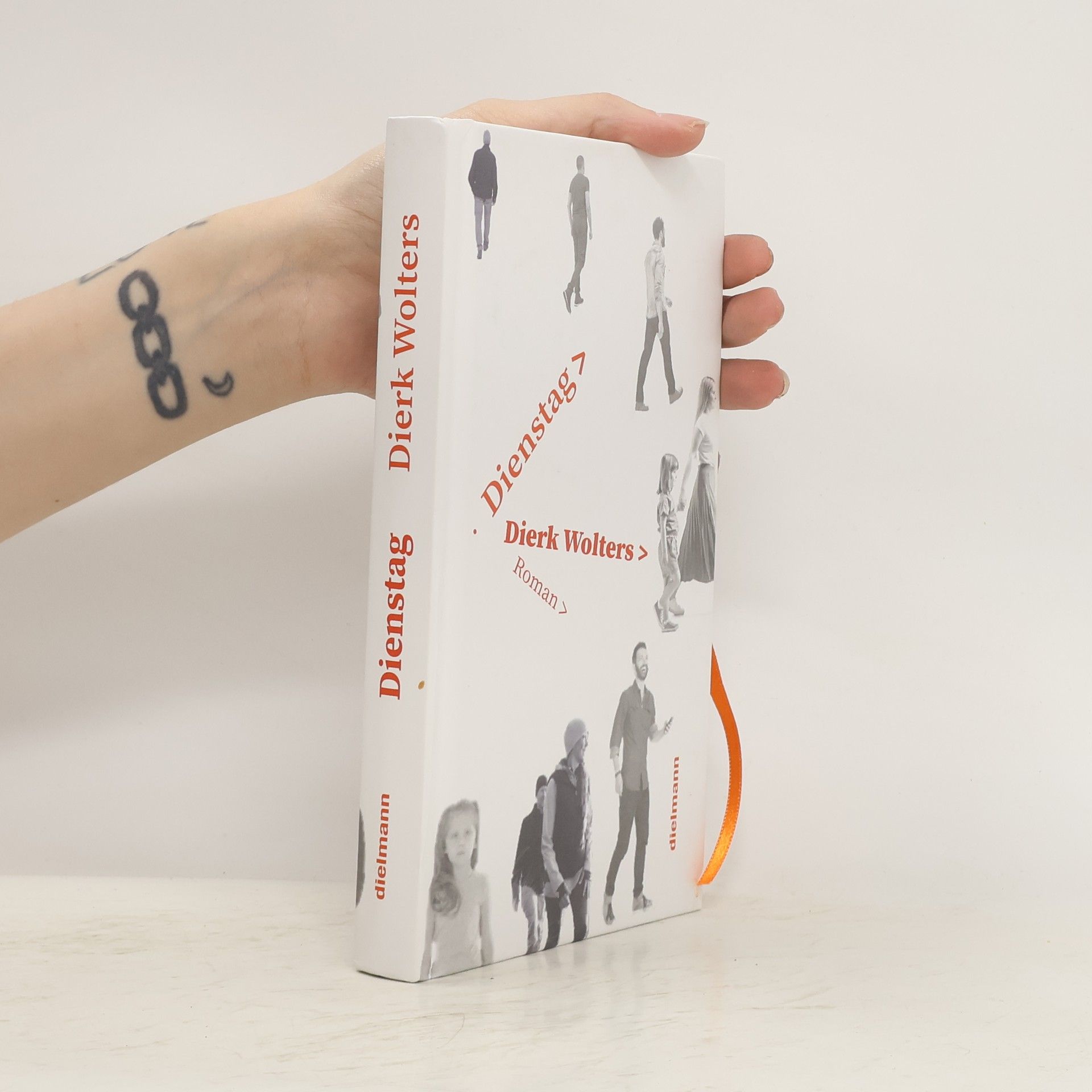Dienstag
Roman
Die Uhr tickt an einem scheinbar normalen Dienstag, während Dierk Wolters’ Erzählzeiger zwischen sechs Familienmitgliedern springt und deren Gedanken und Gefühle offenbart. Vom Großvater bis zum Nesthäkchen, von mütterlichen Sorgen bis zu Konflikten im Altenheim, von Freizeitsport bis zu beruflichen Herausforderungen – die inneren Stimmen sind vielfältig und kommentieren sich gegenseitig. Die Gedankensplitter und inneren Monologe sind teils amüsant, teils tiefgründig und oft vertraut. Besonders spannend ist das, was zwischen den Figuren geschieht oder auch nicht. Die Rede- und Denkzeiten, die Wolters seinen Charakteren einräumt, regen zum Nachdenken an: Wie organisieren wir unser Leben? Wie definieren wir das Miteinander, wenn Mutmaßungen und Selbstüberzeugungen Gespräche ersetzen? Die gesellschaftlichen Rollen und Positionen scheinen uns mehr zu trennen als zu verbinden. Nähe und Distanz, Fremd- und Selbstbestimmung sind in unseren Köpfen präsent, bleiben aber oft unartikuliert und halten uns voneinander fern. In den Sprüngen, die Wolters an der Uhr seines „Dienstags“ abliest, wird der Roman zu einem Chronometer für vertane oder lebenswert gemachte Zeit. Es ist also Dienstag …