Ingo Breuer Libri
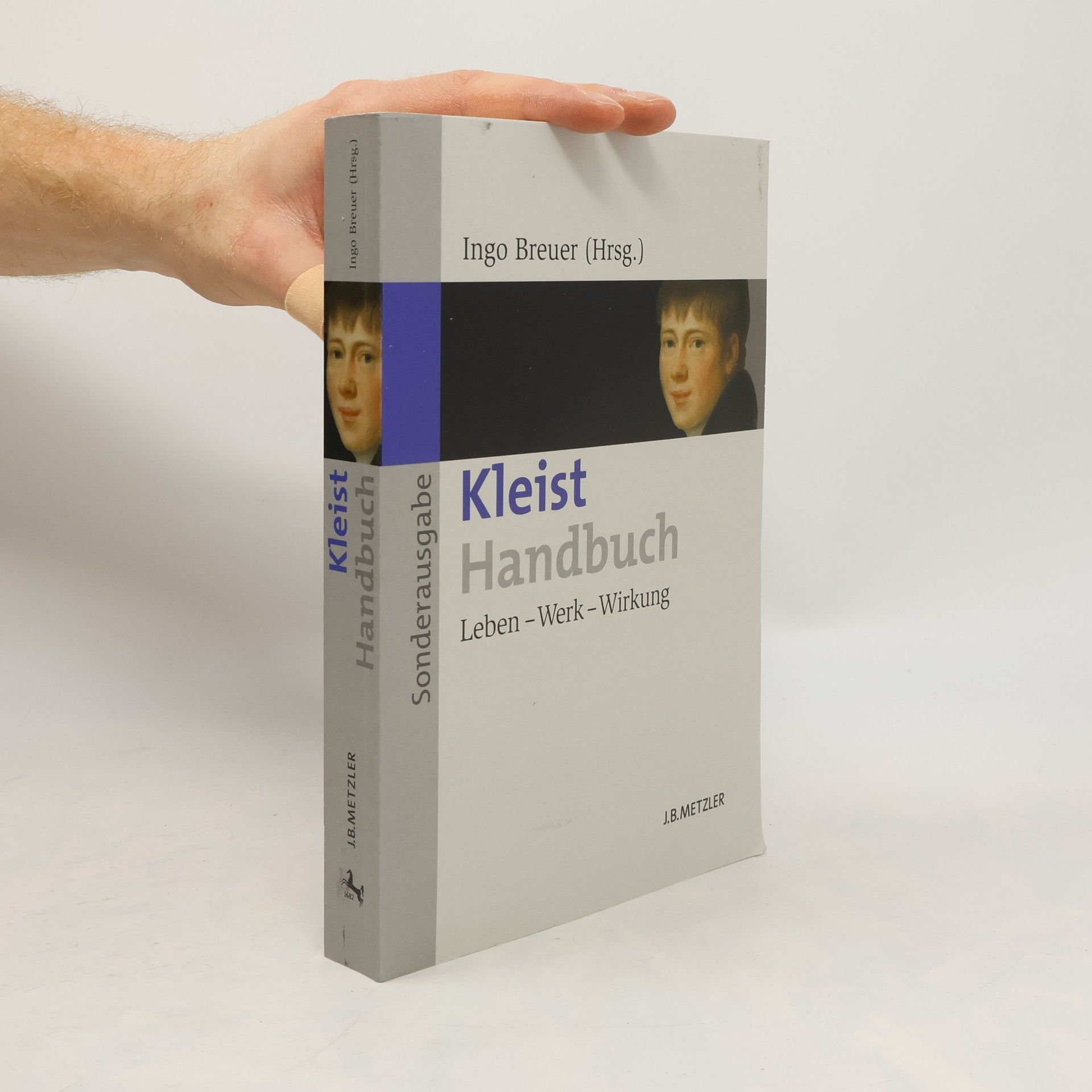

Auf den Spuren Kleists. Er fasziniert nicht nur durch seine ratselhafte Personlichkeit auch Kleists Werke entfachen oftmals Kontroversen. Immer wieder werden sie zum Prufstein neuer wissenschaftlicher Fragestellungen. Das Handbuch bundelt die komplexe Forschungslage und prasentiert Leben, Werk und Wirkung. Weitere Kapitel informieren uber Themen und Diskurse, mit denen sich Kleist auseinandergesetzt hat. Fundiertes Grundwissen und nutzliche Anregungen fur eine umfassende Beschaftigung mit Heinrich von Kleist."