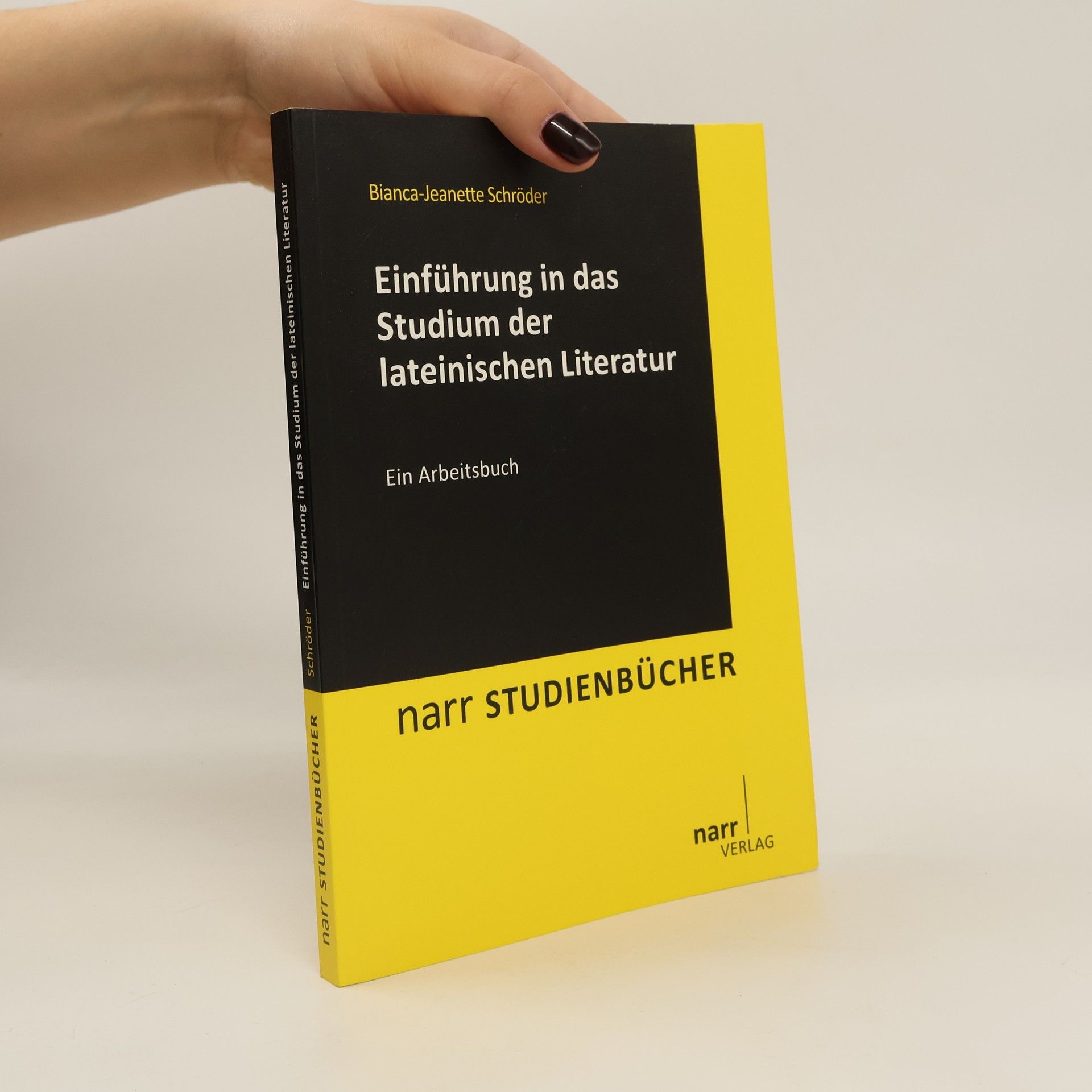Einführung in das Studium der lateinischen Literatur
Ein Arbeitsbuch
Die Einführung richtet sich an Studierende der BA-Latein-Studiengänge im Grundstudium, sie ist für das Selbststudium konzipiert, kann aber auch in Kursen eingesetzt werden. Gegenüber vorhandenen Einführungen in die lateinische Philologie, die oft für Studierende im Grundstudium zu schwer verständlich sind, setzt diese Einführung bei Inhalten und Fertigkeiten an, deren Kenntnis bei den heutigen BA-Studierenden nicht mehr einfach vorausgesetzt werden kann. Es wird in grundlegende Arbeitstechniken, Fragestellungen und Inhalte eingeführt: In Teil I stehen Lese-Techniken im Mittelpunkt: „Verstehen und Übersetzen“ und „Methoden der intensiven und extensiven Texterschließung“. In Teil II werden zentrale Aspekte verschiedener Themen be rei che systematisch vorgestellt: „Literatur in Rom“, „Mythos“, „Drama“, „Philosophie“, „Rhetorik“, „Geschichte“. Alle Kapitel werden von Textausschnitten (mit Übersetzung), Arbeitsaufträgen und Übungen begleitet.