Selbstbehauptung nach dem Holocaust
Die jüdische Gemeinde Gelsenkirchen nach 1945

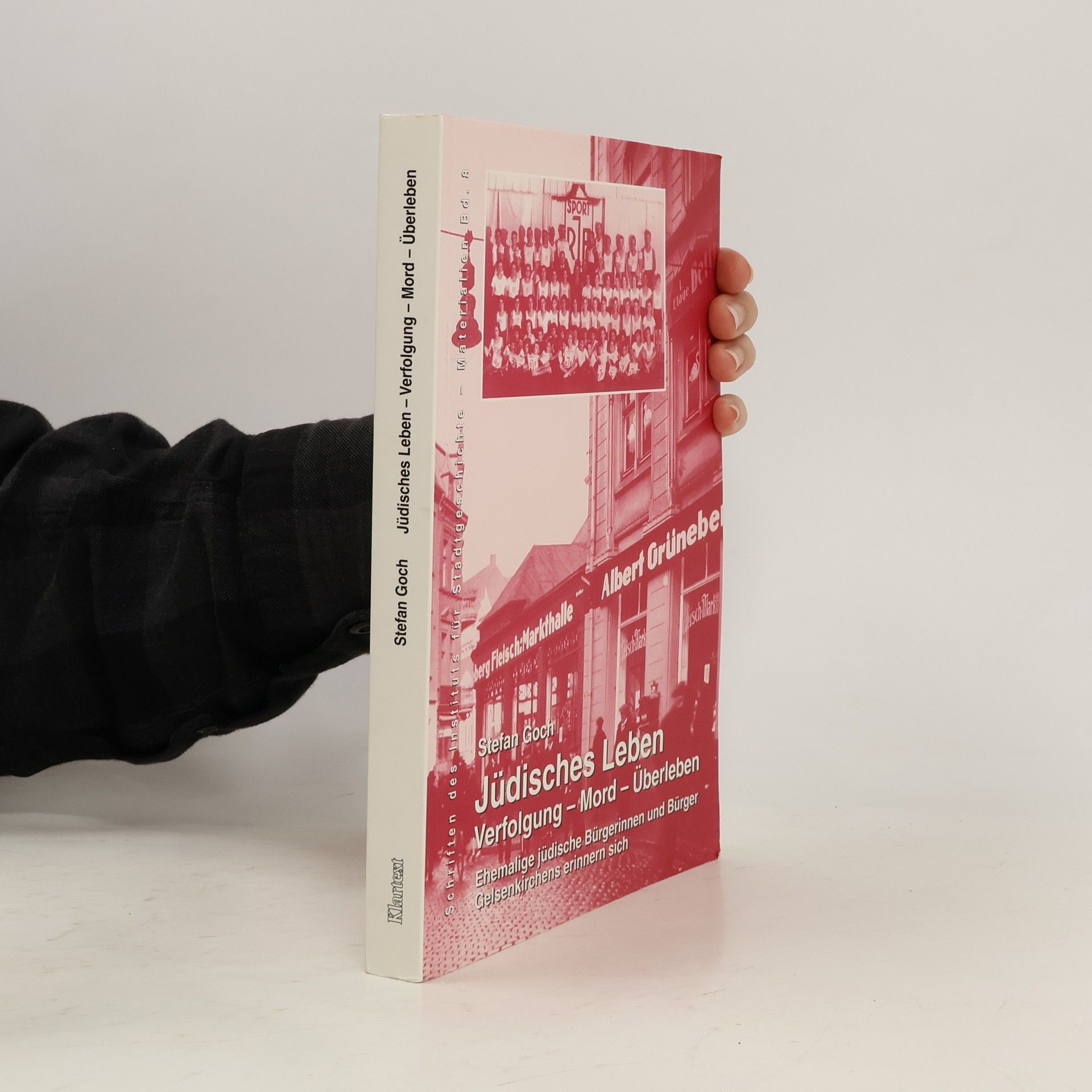
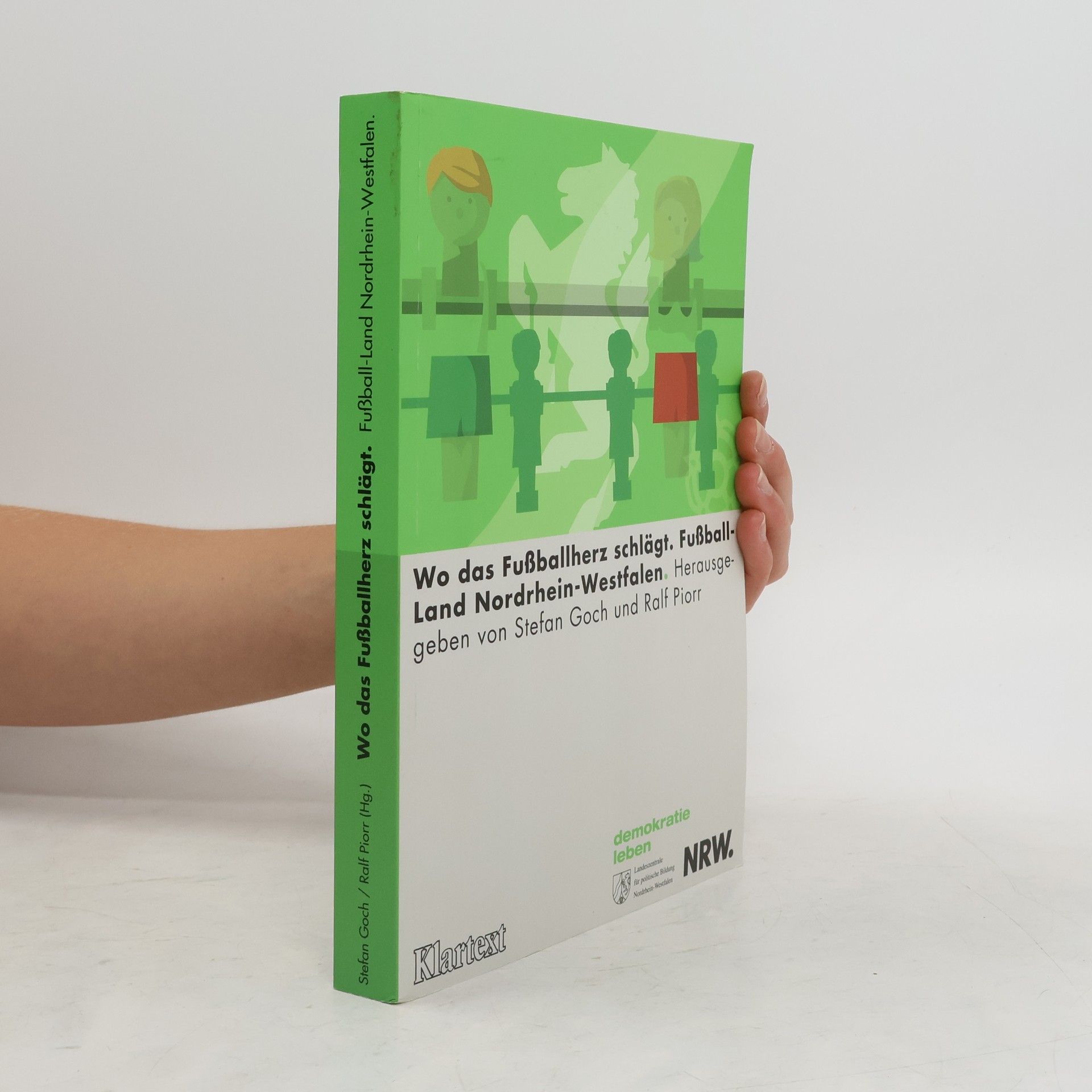


Die jüdische Gemeinde Gelsenkirchen nach 1945
Die Geschichte der Stadt Gelsenkirchen ist ebenso wechselhaft wie spannend. Dörfer mit einer gar nicht so kurzen Geschichte wurden im Industriezeitalter zu einer Großstadt neuen Typs zusammengefasst, diese Stadt stieg in wenigen Jahrzehnten zu einem der wichtigsten Industriestandorte des europäischen Kontinents auf und durchlebt seit Jahrzehnten einen dramatischen Strukturwandel. So spiegelt sich in der Gelsenkirchener Geschichte beispielhaft die bewegte Geschichte des Ruhrgebietes – in wirtschaftlicher und sozialer ebenso wie in politischer und kultureller Hinsicht. Diese Stadtgeschichte soll einen Überblick über wichtige Entwicklungen Gelsenkirchens geben und zu einer Selbstvergewisserung über das Gemeinwesen „Gelsenkirchen“ beitragen. Das Buch ist als ein Angebot zu verstehen, warum Gelsenkirchen und seine Menschen so geworden sind, wie sie sind. Darüber hinaus soll es Anregung sein, Gelsenkirchen weiterzudenken und weiterzuentwickeln, damit es wird, wie die Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener wollen, das es wird
Der Westen mit dem Ruhrgebiet und Nordrhein-Westfalen ist seit Ende des Zweiten Weltkriegs eine Fußballregion mit besonderer Prägung. „Das Herz des deutschen Fußballs schlägt im Ruhrgebiet“ urteilte Franz Beckenbauer vor einigen Jahren. Von den über 6,27 Millionen Mitgliedern im DFB kommen rund 1,4 Millionen aus nordrhein-westfälischen Fußballvereinen. Damit steht NRW im Vergleich zu den übrigen Bundesländern an 1. Stelle der Mitgliederstatistik. Gleiches trifft für die Zahl der Vereine und der Mannschaften zu. Gestützt wird dies durch die Begeisterung der Fans: Woche für Woche strömen Hunderttausende zu den Fußballplätzen im Land. Mit der WM 2006 feiert Nordrhein-Westfalen sein sechzigjähriges Bestehen als Bundesland. Das Buch zur Geschichte des Fußballs in NRW liefert Geschichten, Hintergründe und Analysen rund um Spieler, Vereine und Meisterschaften. Es geht aber nicht nur um die „großen“ Vereine, denn Fußball hat hier auch abseits der großen Arenen und Stadien eine Tradition wie wohl nirgendwo sonst in Deutschland.
Nach den Besuchsprogrammen der Stadt Gelsenkirchen für ehemalige jüdische Bürgerinnen und Bürger und zahlreichen Kontakten mit Überlebenden der Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden wird hier eine kommentierte Sammlung lebensgeschichtlicher Erinnerungen ehemaliger jüdischer Bürgerinnen und Bürger Gelsenkirchens vorgelegt. Die gesammelten Erinnerungsberichte während des „Dritten Reiches“ verfolgter Menschen decken ein breites Spektrum unterschiedlicher Lebenswege ab und führen von Gelsenkirchen in die Vernichtungslager und bei den Menschen, die überlebten, in alle Welt. Die Erinnerungsberichte zeigen in unterschiedlicher Weise die Folgen von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Nationalsozialismus und Gewalt. Sie geben den Opfern eine Persönlichkeit und ein Gesicht. Mit der Publikation von Lebensberichten überlebender jüdischer Menschen aus Gelsenkirchen wird auch dem Wunsch vieler Pädagogen entsprochen, ihnen biographisches Material für die gesellschaftswissenschaftliche Bildung zur Verfügung zu stellen, weil sich der menschenverachtende und verbrecherische Charakter des Nationalsozialismus in der Bildungsarbeit oft besonders gut durch persönlichere Schilderungen vermitteln lässt.
Nordrhein-Westfalen ist als das industrielle Kernland Westdeutschlands seit vielen Jahren von einem tief greifenden Strukturwandel betroffen wie kein zweites Bundesland. Der Niedergang von klassischen Industriezweigen etwa in den Bereichen Kohle und Stahl oder auch in der Textilwirtschaft stellen Wirtschaft und Politik gleichermaßen vor große Herausforderungen. Neue Technologien, Verfahren und Produkte und der vielfältige Dienstleistungssektor (so z. B. in den Bereichen Umweltwirtschaft, Logistik, Medien, Bildung, Tourismus) bieten attraktive neue Entwicklungsmöglichkeiten, können aber allein den Verlust von Industriearbeitsplätzen kaum kompensieren. Die Beiträge dieses Bandes schildern die historische Entwicklung dieses Strukturwandels und gehen der Frage nach, wie weit strukturpolitische Maßnahmen den wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Wandel unterstützen und steuern können. Dabei gilt dem Vergleich mit ähnlichen Anpassungsprozessen in ausgewählten europäischen Regionen und den Perspektiven für das Land Nordrhein-Westfalen besonderes Augenmerk. In dem Band kommen nicht nur Experten aus der Wissenschaft zu Wort, sondern auch an der Gestaltung des Strukturwandels beteiligte Akteure wie Unternehmerinnen und Unternehmer und auch Vertreter von Interessenverbänden.