Epochen, Gattungen, Stilbegriffe - in rund 1.000 Einträgen werden die literarischen Epochen (von Aufklärung bis Surrealismus), die wichtigsten Gattungen (von Autobiographie bis Volkslied) und wesentlichen Stilbegriffe (von Alliteration bis Zeugma) anschaulich dargestellt.
Heike Gfrereis Libri

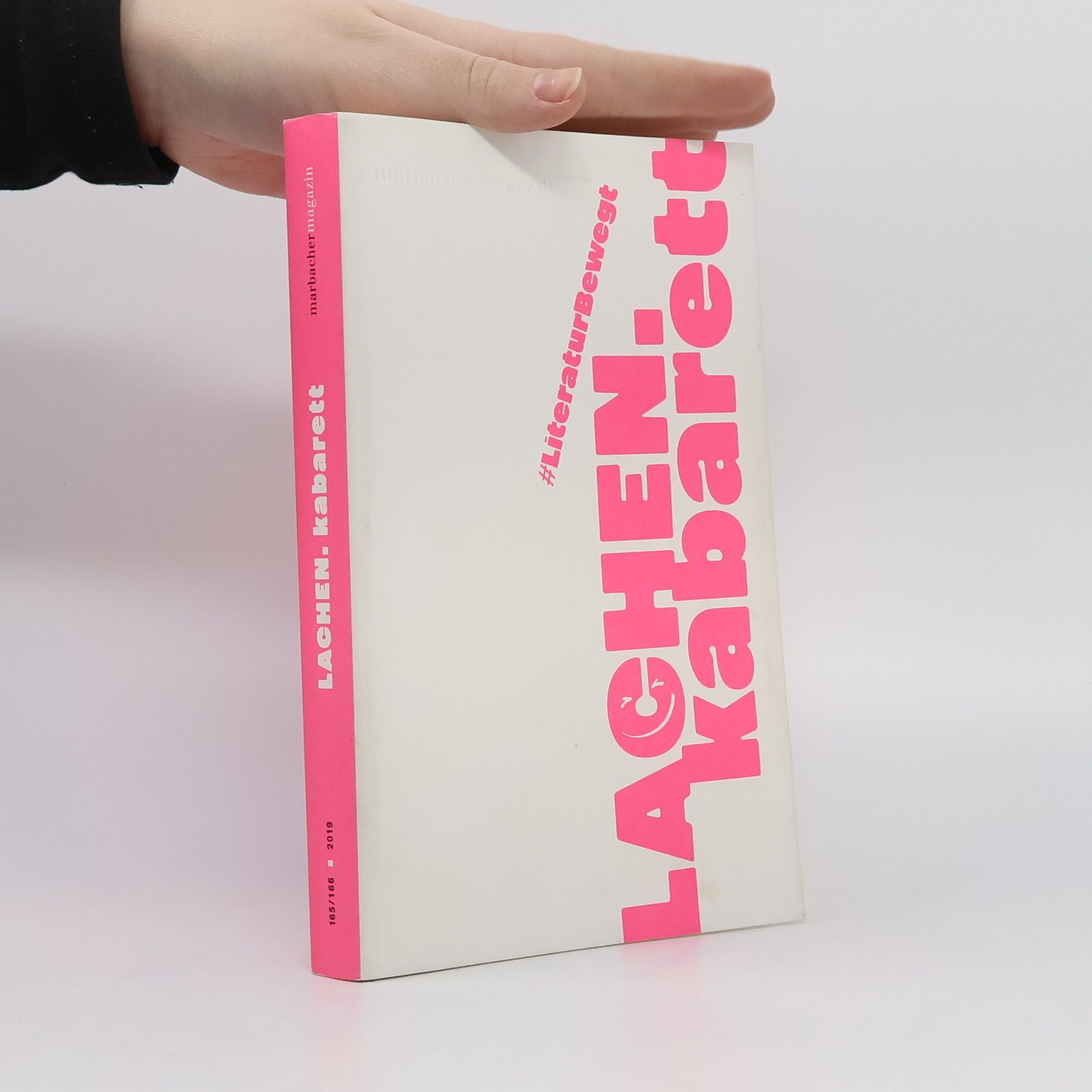

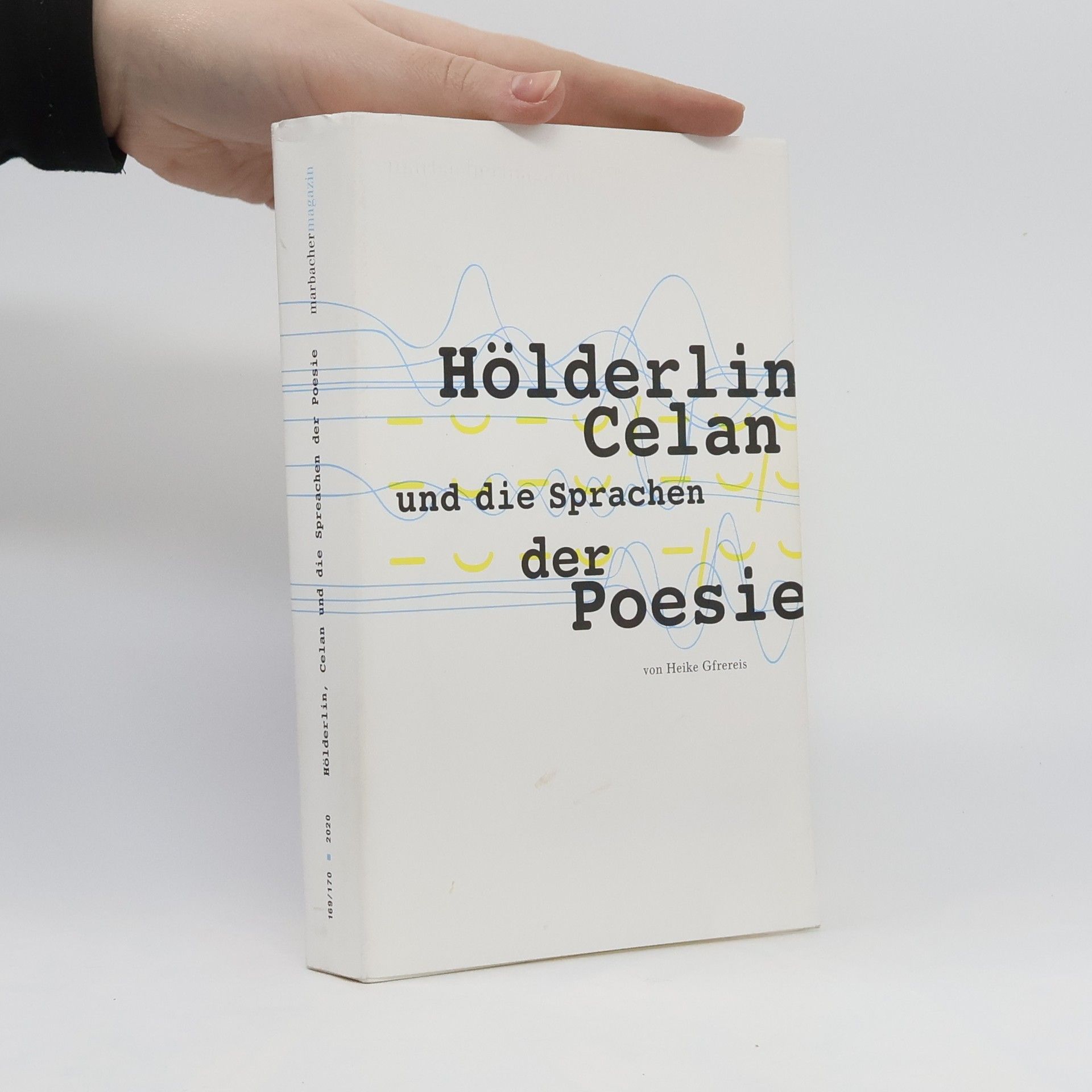
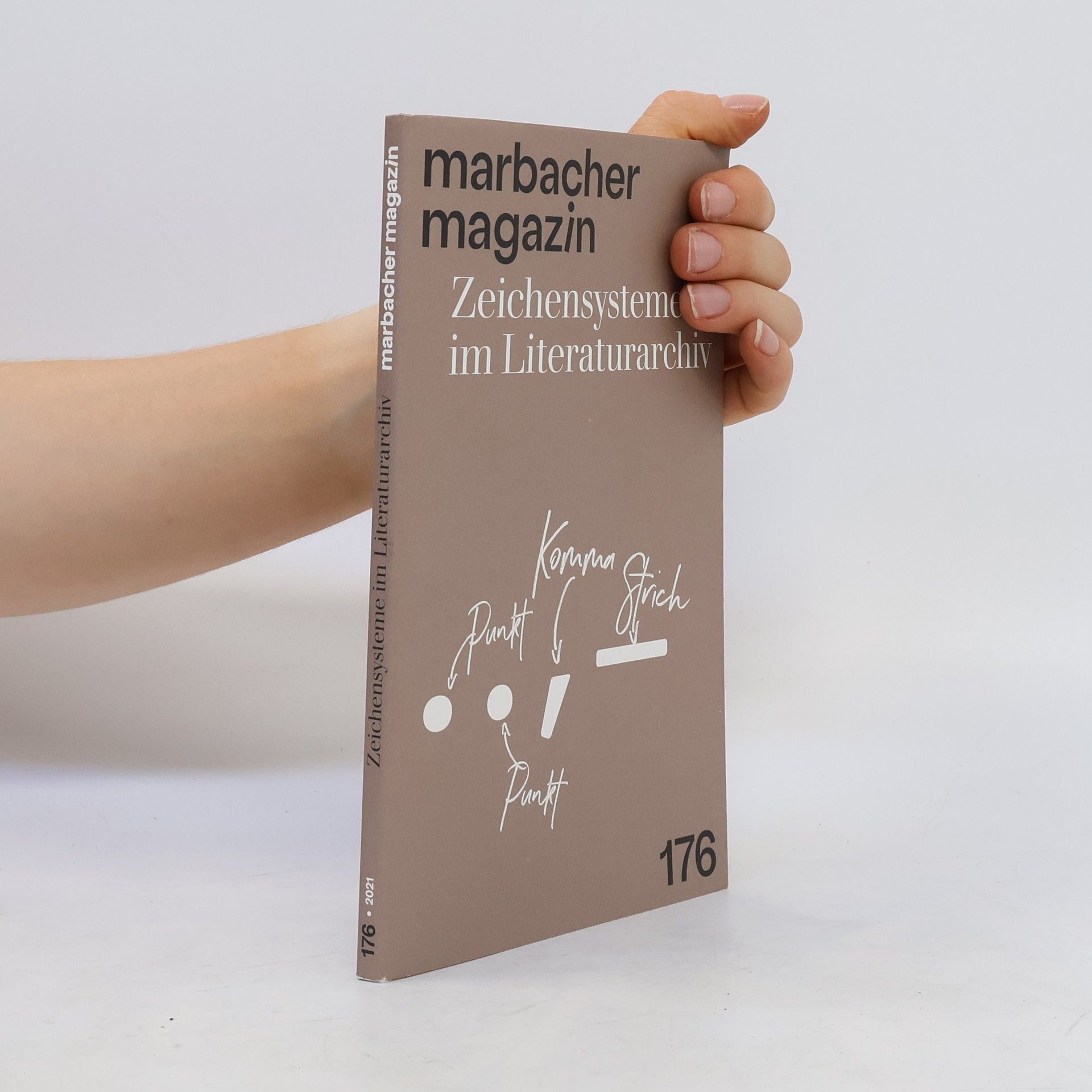
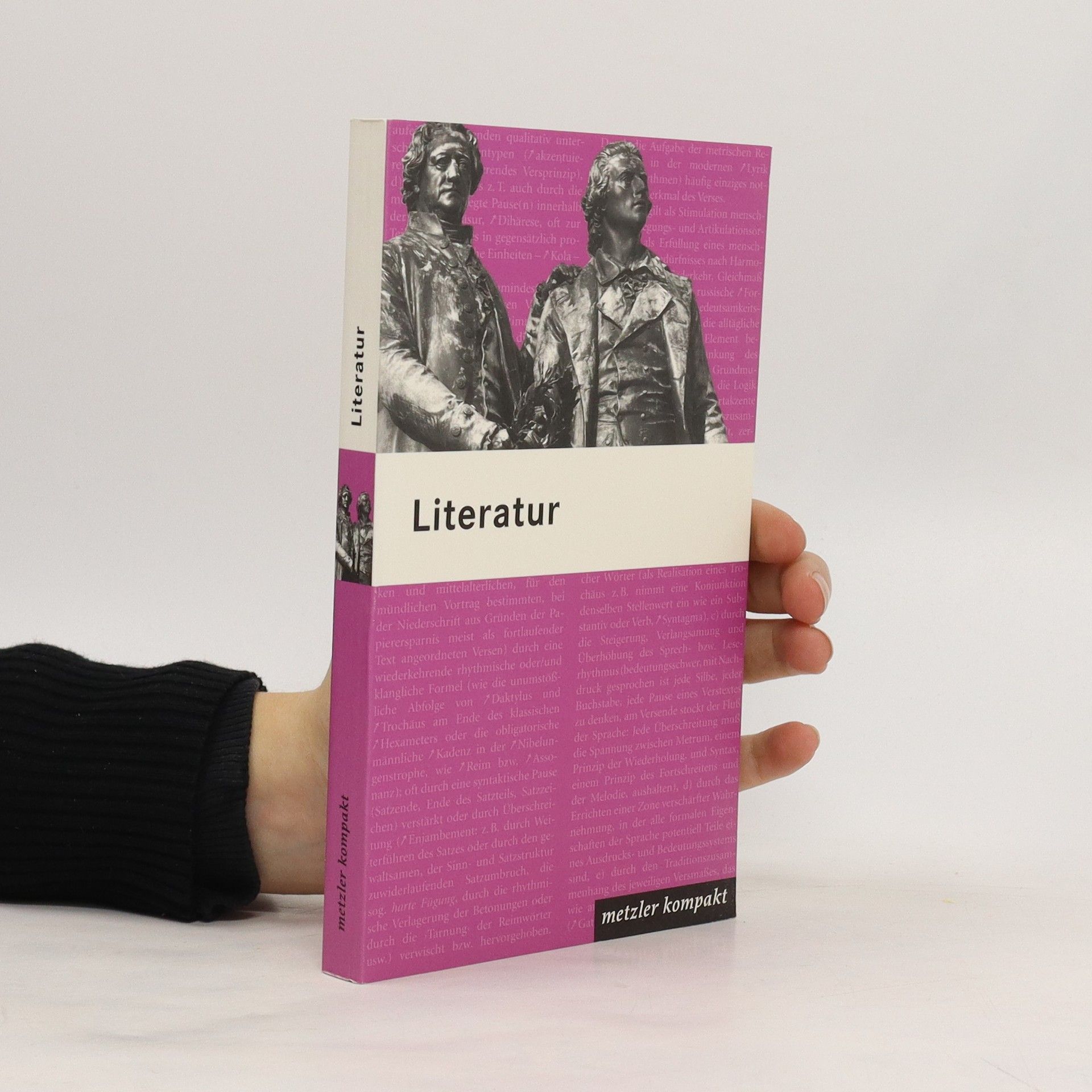
In einem Literaturarchiv gibt es mehr als nur Buchstaben und mehr als nur ein ein-ziges Schriftsystem: Es gibt Zahlen und Bilder, Geheim-, Privat- und Computersprachen, die Sprachen der Farben und Papiere, der Spuren und Abdrücke. Verstehen wie Missverstehen gehören zu diesen Zeichen und Sprachen, so wie zum literarischen Text der mehrfache Schriftsinn gehört und zum Archiv das Entzifffern und Rätseln, Staunen und Wundern. Wenn Schriftstellerinnen und Schriftsteller die Codes ihrer Zeit und der Literatur aufgreifen, so weil sie Texte erschaffen möchten, die Verstehensprozesse auslösen, mit denen etwas entsteht, was sonst nicht da wäre: Zeichen lösen Handlungen, Wahrnehmungen und Gefühle aus, markieren Wege, Grenzen und Verknüpfungen, kommunizieren mit Menschen und Maschinen. Das vorliegende Magazin begleitet die gleichnamige Marbacher Ausstellung und ist zugleich ein eigenständiges Kompendium zum Thema Zeichensysteme in der Literatur. Exhibition: Literaturmuseum der Moderne, Marbach am Neckar, Germany (07.11.2021 - 24.04.2022)
"'Hölderlin ist eine dem Deutschen verwandte Sprache', fand Oskar Pastior. Der reich bebilderte Katalog zur Ausstellung 'Hölderlin, Celan und die Sprachen der Poesie' folgt den unterschiedlichen archivierbaren Erscheinungsweisen dieser Sprache: Wie liest man Hölderlins Gedichte im Manuskript ? von den frühen tammbuchversen über die Hymnen bis zu den späten Scardanelli-Gedichten? Welche Hölderlin-Erfahrungen sind überliefert -- von Eduard Mörike über Rainer Maria Rilke, Hermann Hesse, Hannah Arendt, Ingeborg Bachmann und Paul Celan bis zu W. G. Sebald und Robert Gernhardt? Was bleibt von den Sprachen der Poesie im Archiv -- von 'Schön' und 'Nur für Dich' über 'Atmen' und 'Zerlegen' bis 'Verklären' und 'Unsicher'?" -- Back cover (jacket)
Hands on!
Schreiben lernen, Poesie machen
Wie lernen wir schreiben? Wie beginnen wir, von Hand Buchstaben zu formen und daraus dann Wörter und Sätze und: Literatur zu bauen? Im Marbacher Magazin zu der von Hans Magnus Enzensberger angeregten Ausstellung erkunden Heike Gfrereis und Sandra Richter im Vorwort Grundlagen, Geschichten und Perspektiven des Schreibens und Denkens mit der Hand, Hans Magnus Enzensberger und Jan Bürger fragen im Gespräch unter dem Titel »Kritzeln, schreiben, wischen«: Ist die Epoche der Handschrift vorbei? Und schließlich zeigen Schulhefte, Kinderbriefe, Schreibübungen, Schriftspiele und Buchstabenerfindungen von Friedrich Schiller bis Theresia Enzensberger, welche Folgen Schönschreibzwang und Ausdruckswille haben können. Kommentiert werden sie von Ulla Berkéwicz, Rotraud Susanne Berner, Cornelia Funke, Heike Gfrereis, Durs Grünbein, Vera Hildenbrandt, Felicitas Hoppe, Lea Kaiser, Alexander Kluge, Martin Kuhn, Tamara Meyer, Lydia Christine Michel, Judith Schalansky und Yoko Tawada.
Nie wird, so scheint es, so viel gelacht wie in Krisenzeiten. Lachen ist menschlich, Lachen stiftet Gemeinsamkeiten, Lachen befreit. Aber Lachen kann auch todtraurig sein oder bitterböse und gemein. Das Marbacher Magazin spürt – wie die gleichnamige Ausstellung – den Varianten des Lachens im Literaturarchiv nach: Welche Texte begünstigen welches Lachen? Diese Frage führt auch ins Zentrum des Kabaretts, das an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert entsteht und als Kulturform die Zuschauer einbezieht, Lachen provoziert und oft zugleich das Gegenteil bewirken will: Verstörung im Angesicht der Wirklichkeit, Aufruf zur politischen Aktion. 135 Muskeln sind am Lachen beteiligt. Die Autorinnen und Autoren des Marbacher Magazins stellen Texte, Bilder und Gegenstände von Friedrich Schiller bis Robert Gernhardt vor, die Gelegenheit zum Lachmuskeltraining geben, aber auch die Ambivalenz des Themas reflektieren.
Grundbegriffe der Literaturwissenschaft
- 300pagine
- 11 ore di lettura
Der Band erläutert in über 1.000 Einträgen die wichtigsten Begriffe der Literaturwissenschaft: die gebräuchlichsten Bezeichnungen der Literaturgeschichtsschreibung und Textkritik, die wesentlichen Gattungen, rhetorischen Figuren, die Vers- und Strophenformen, etc. Zudem werden die richtungsweisenden literaturwissenschaftlichen Methoden und Ansätze erläutert. Beispiele, Querverweise und Lektüreempfehlungen helfen dabei, sich mit den Fachbegriffen zugleich das für das Studium notwendige Grundwissen zu erarbeiten.