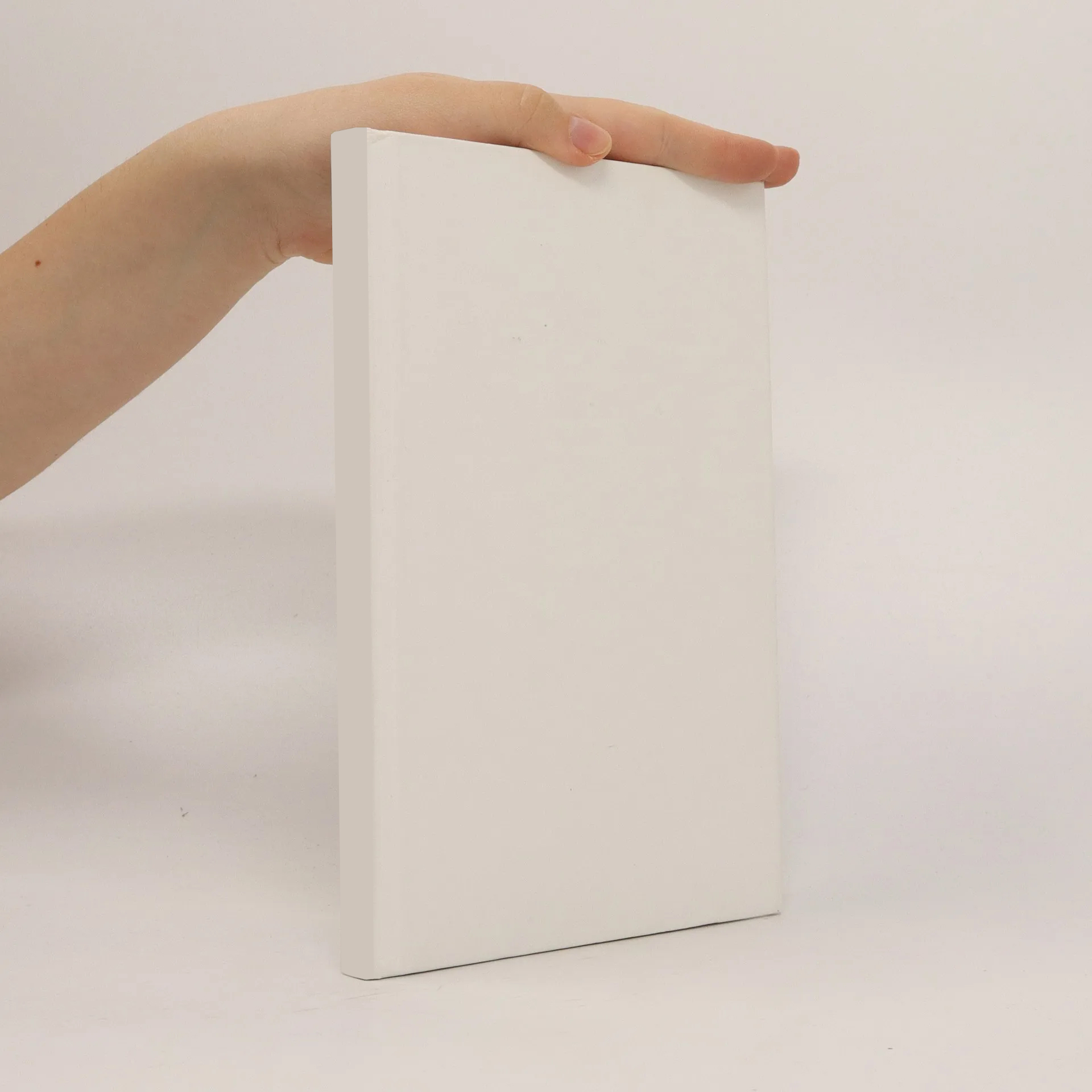
Parametri
Maggiori informazioni sul libro
Die Darstellung beginnt mit der Vorstellung, dass im paradiesischen Zustand keine Eigentumsrechte, staatliche Zwangsgewalt oder Unfreiheit existierten. Diese Einrichtungen wurden erst nach dem Sündenfall notwendig, um die verderbten Menschen zu zügeln. Die ursprüngliche Freiheit und Gleichheit der Menschen sowie die gemeinsame Nutzung aller Güter wurden als Normen des Naturrechts angesehen. Für spätantike Theologen und mittelalterliche Autoren war der Übergang von dieser ursprünglichen Freiheit zu den nach dem Sündenfall gültigen Herrschafts- und Eigentumsverhältnissen ein erklärungsbedürftiges Problem. Der Wandel wurde als notwendig und göttlich vorbestimmt anerkannt, doch die Autoren argumentierten in teils heftiger Polemik unterschiedlich. Die staatliche Ordnung wurde sowohl kritisch als Folge von Herrschsucht als auch positiv als Ordnungsfaktor für sündige Menschen bewertet. Eigentum galt teils als Ungerechtigkeit, teils als nützliche Einrichtung zur Streitvermeidung. Unfreiheit wurde zunächst als Sündenstrafe akzeptiert, jedoch seit dem 13. Jahrhundert zunehmend als dem göttlichen Recht widersprechend verworfen. Der Autor beleuchtet die unterschiedlichen Argumentationen von Theologen wie Augustin und Thomas von Aquin sowie volkssprachlichen Schriftstellern. Das scheinbar stereotype Grundschema wird in einem vielfältigen Spektrum dargestellt, das einen differenzierten Einblick in die mittelalterliche Diskussion zu Gesellsc
Acquisto del libro
Urzustand und Sündenfall in der mittelalterlichen Gesellschafts- und Staatstheorie, Bernhard Töpfer
- Lingua
- Pubblicato
- 1999
Metodi di pagamento
Ancora nessuna valutazione.