Businesspläne für IT-basierte Geschäftsideen
Betriebswirtschaftliche Grundlagen anhand von Fallstudien
- 310pagine
- 11 ore di lettura
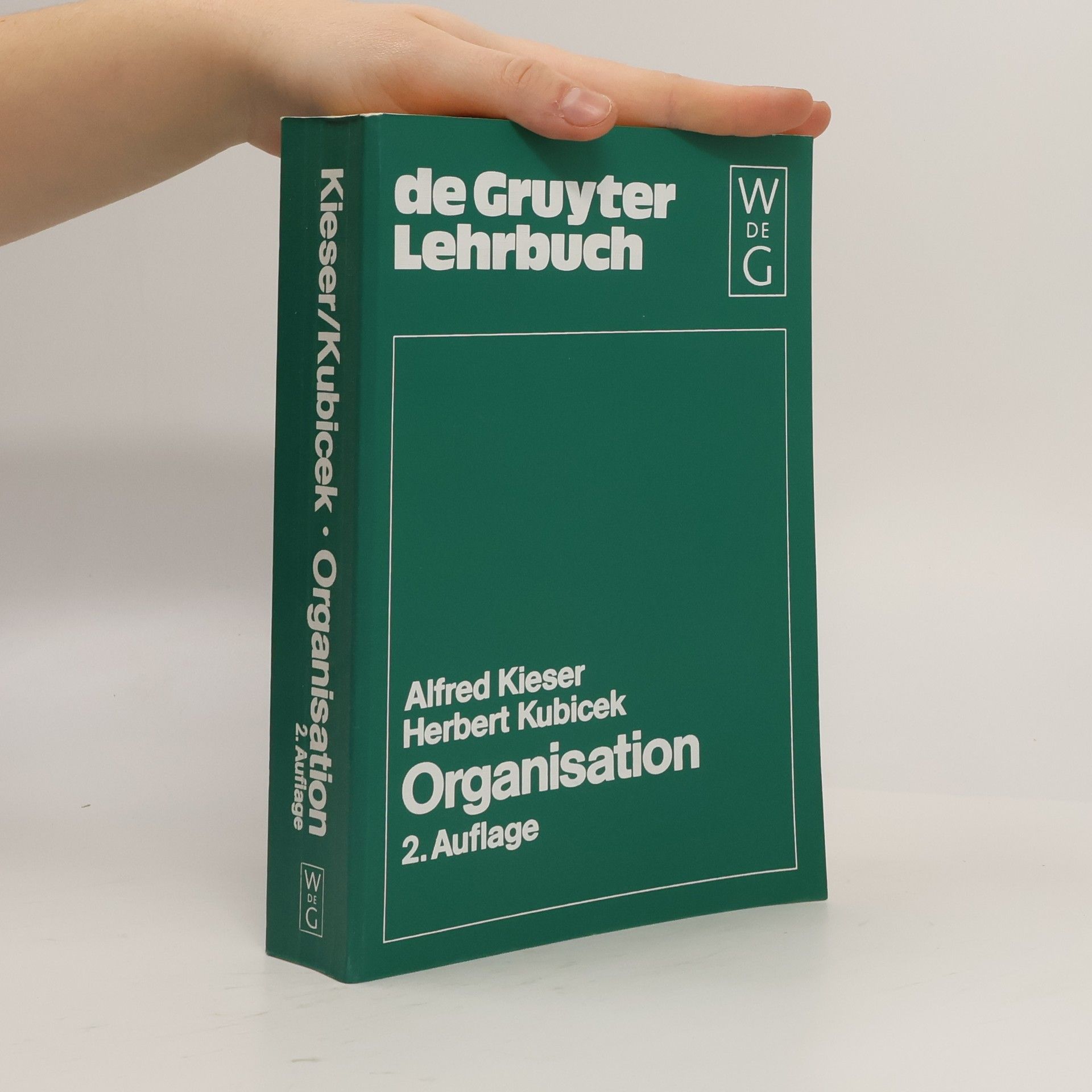
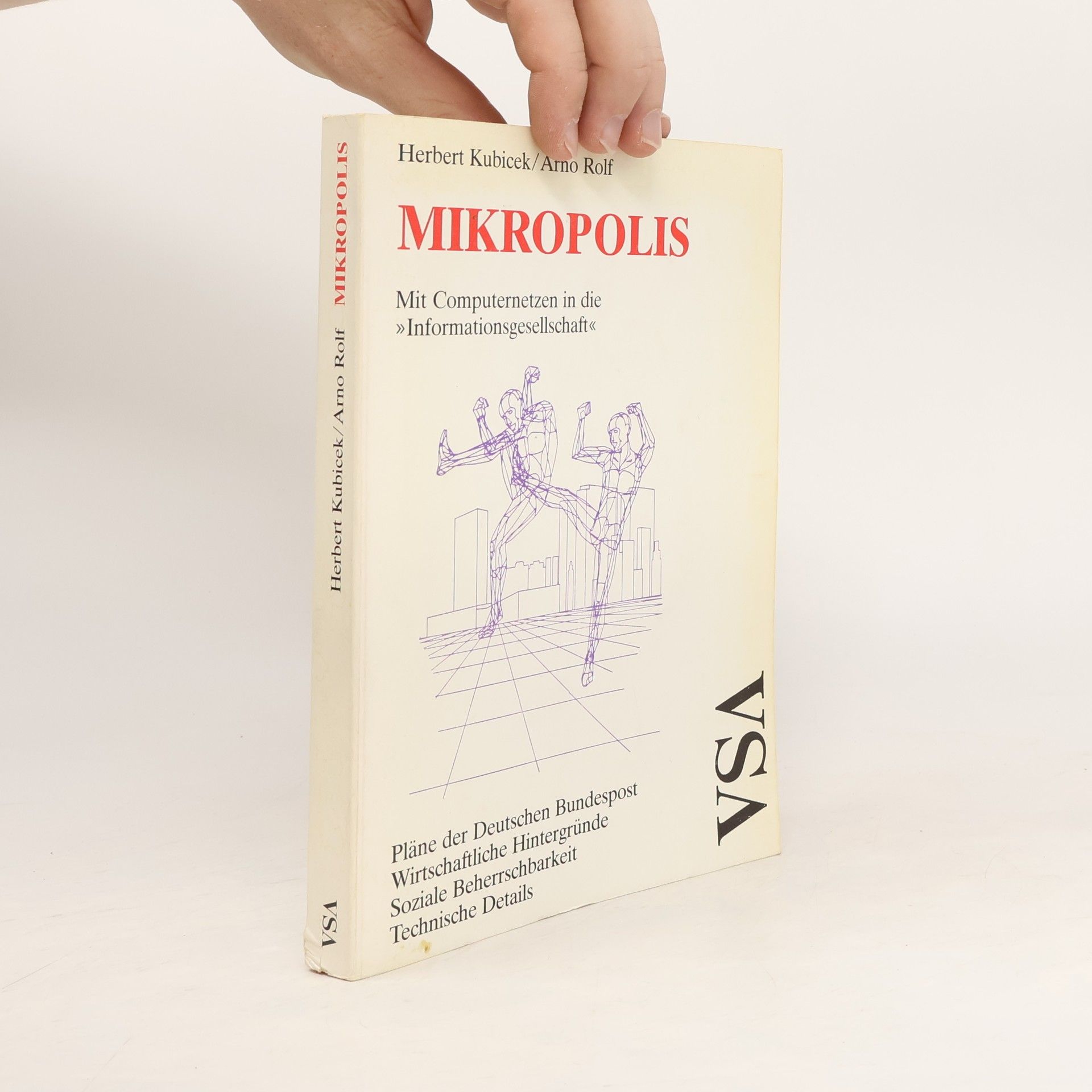
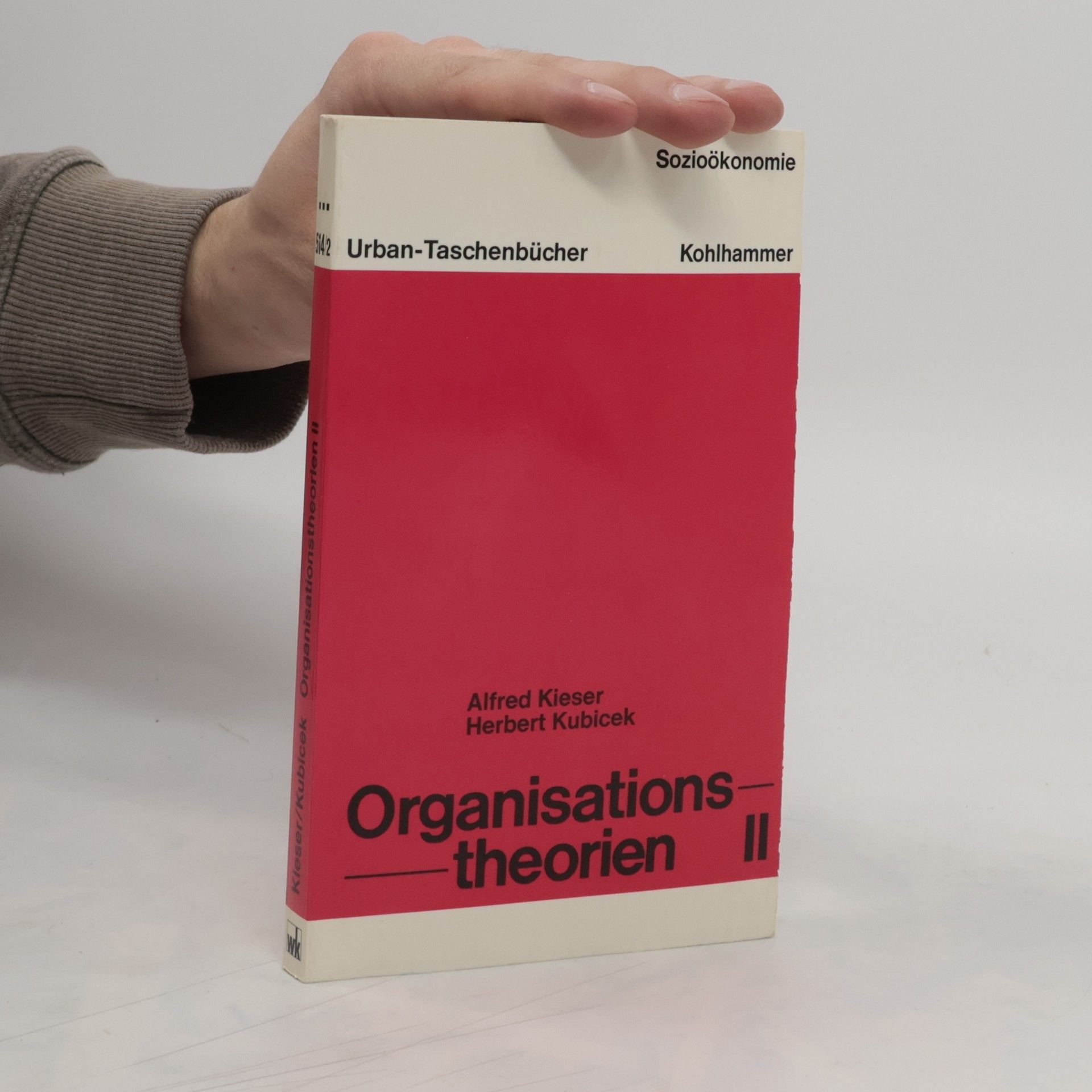
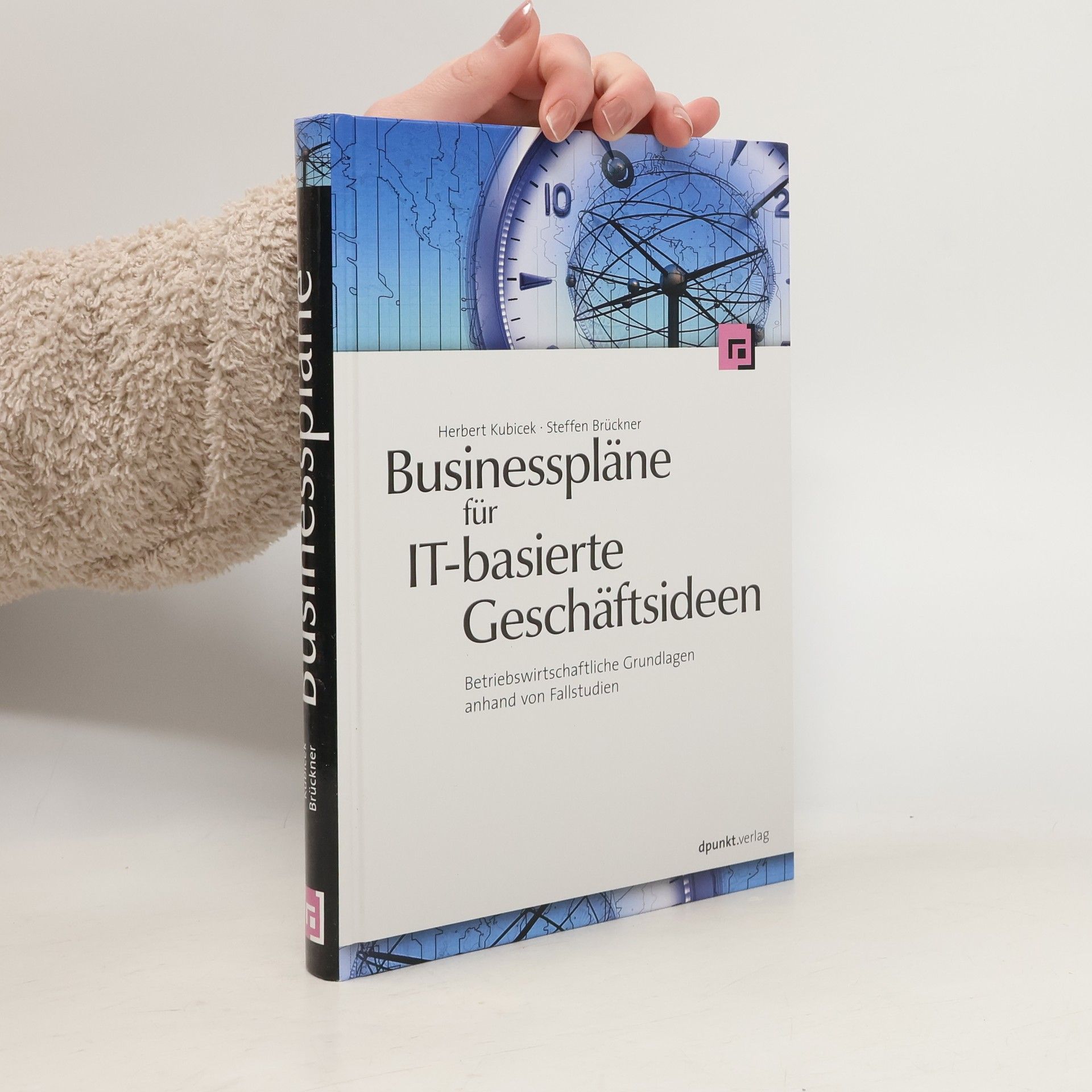
Betriebswirtschaftliche Grundlagen anhand von Fallstudien
Politische Weichenstellungen für den Weg in die Informationsgesellschaft, gegenwärtige Fernmeldenetze und -dienste, Digitalisierung des Fernsprechnetzes und die Integration aller schmalbandigen Dienste im ISDN, Glasfaserverkabelung, Beschäftigungschancen oder -risiken durch die Entwicklung und Anwendung der neuen Kommunikationstechniken, Probleme der sozialen Beherrschung integrierter Fernmeldenetze, Anregungen für eine sozial-orientierte Forschungsentwicklung