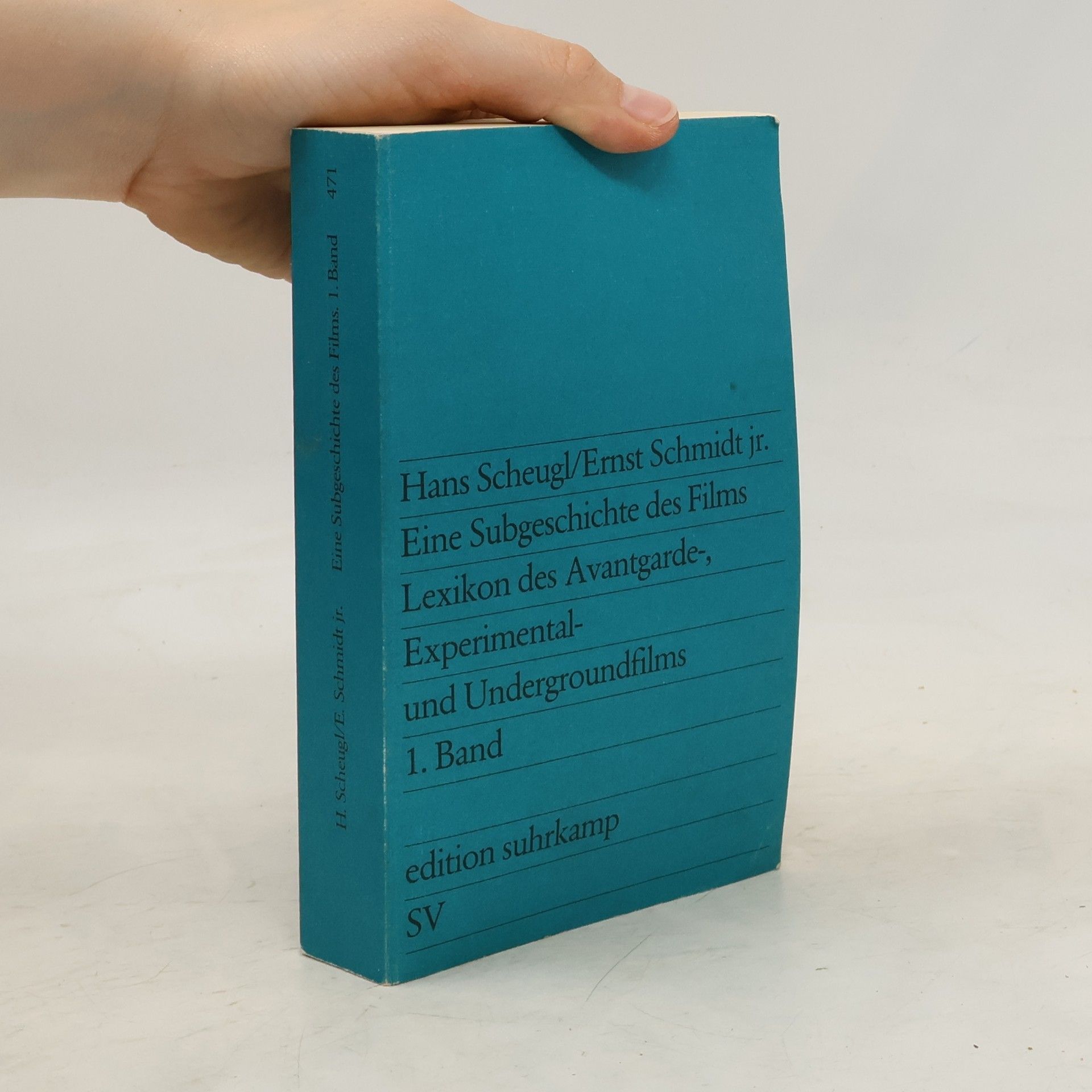Jetzt
Grundlegung einer anthropologischen Theorie historischer Zeit
In recent historiography, key concepts include the separation of historical from natural time, layers of time, proper times ("Eigenzeiten"), temporalization, and the simultaneity of the non-simultaneous. This analysis examines the works of Koselleck, Lepenies, Luhmann, and Hölscher, alongside predecessors like Herder, Pinder, Lovejoy, and Braudel. The critique highlights the confusion between directed time and progress, as well as between progress and history, which leads to the interchangeability of time and history. The separation of natural and historical time is contrasted with their interrelation, while the unity and universality of time are juxtaposed with "Eigenzeiten" and layers of time. The concept of "Verzeitlichung" is replaced by "Vergeschichtlichung," addressing the transformation of natural history (historia naturalis) into the history of nature and the shift of human history towards the principle of progress, which underpins the formula of simultaneity of the non-simultaneous. This counter-design centers on the present and simultaneity, representing fundamental human experiences of time.