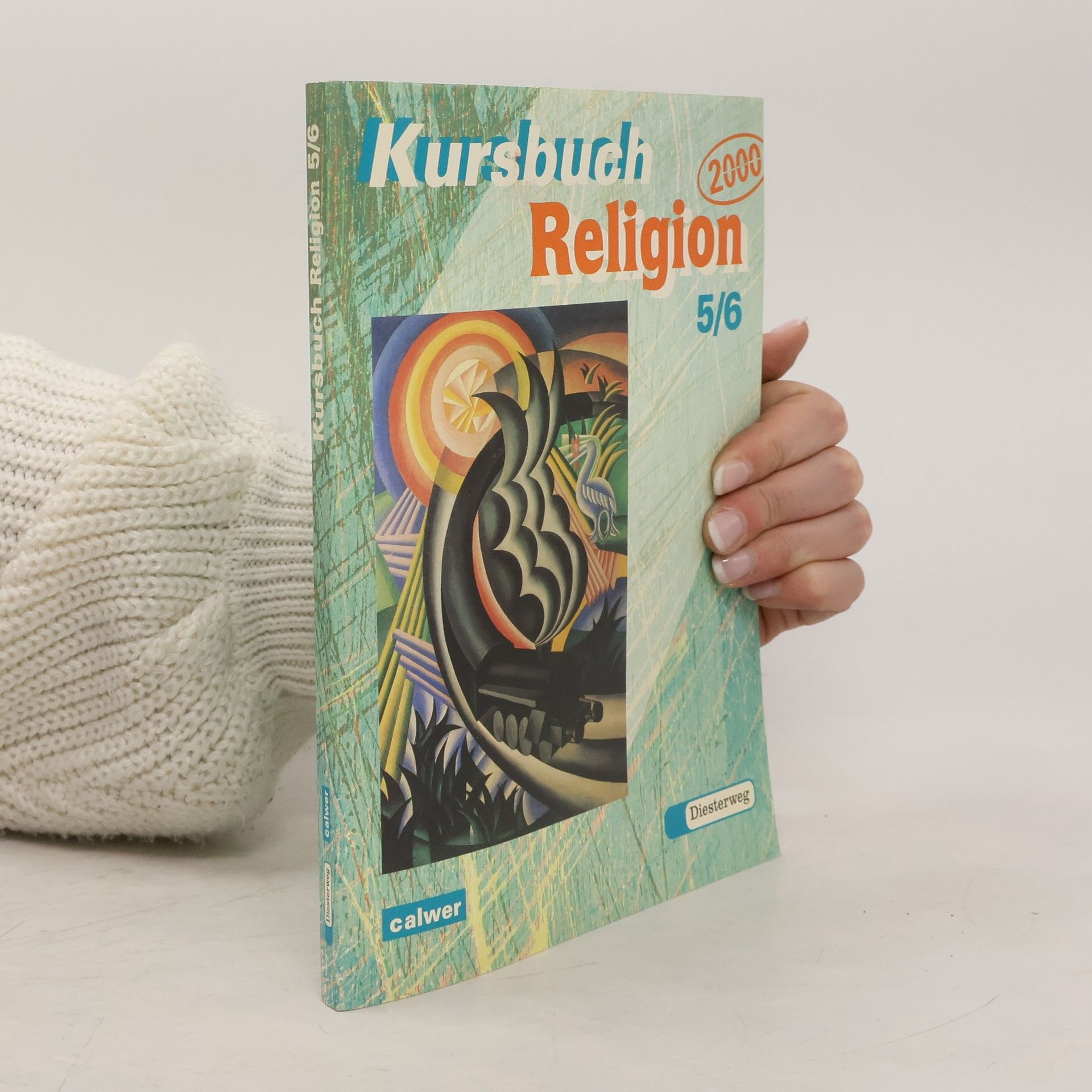Für (kirchen-)geschichtlich Interessierte ist dieser Grundriss der „Geschichte der Kirchen“ die ideale Einführungslektüre. Sprachlich verständlich und gut lesbar wird in 25 Kapiteln das Christentum im Wandel der Zeiten präsentiert.
Jörg Thierfelder Libri
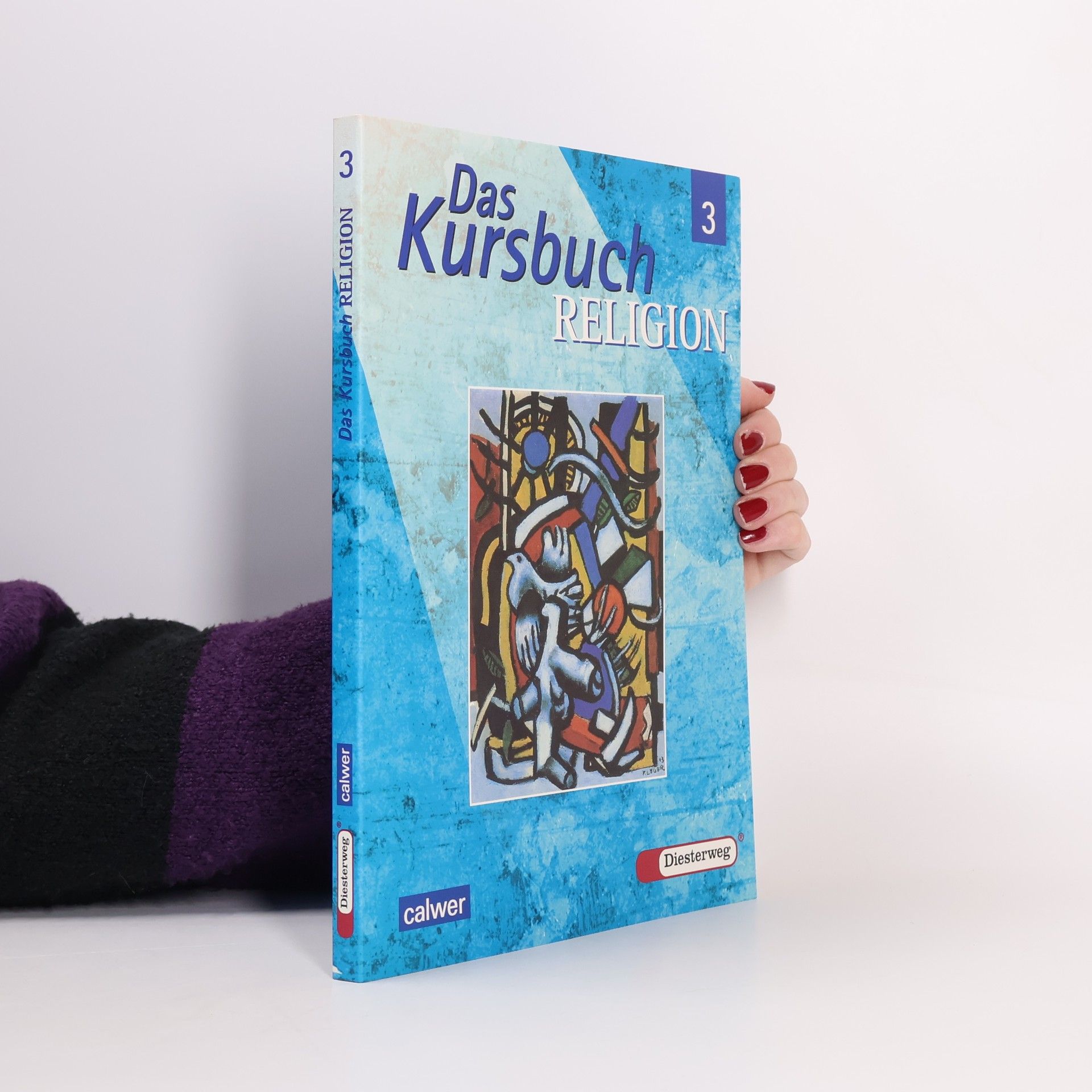
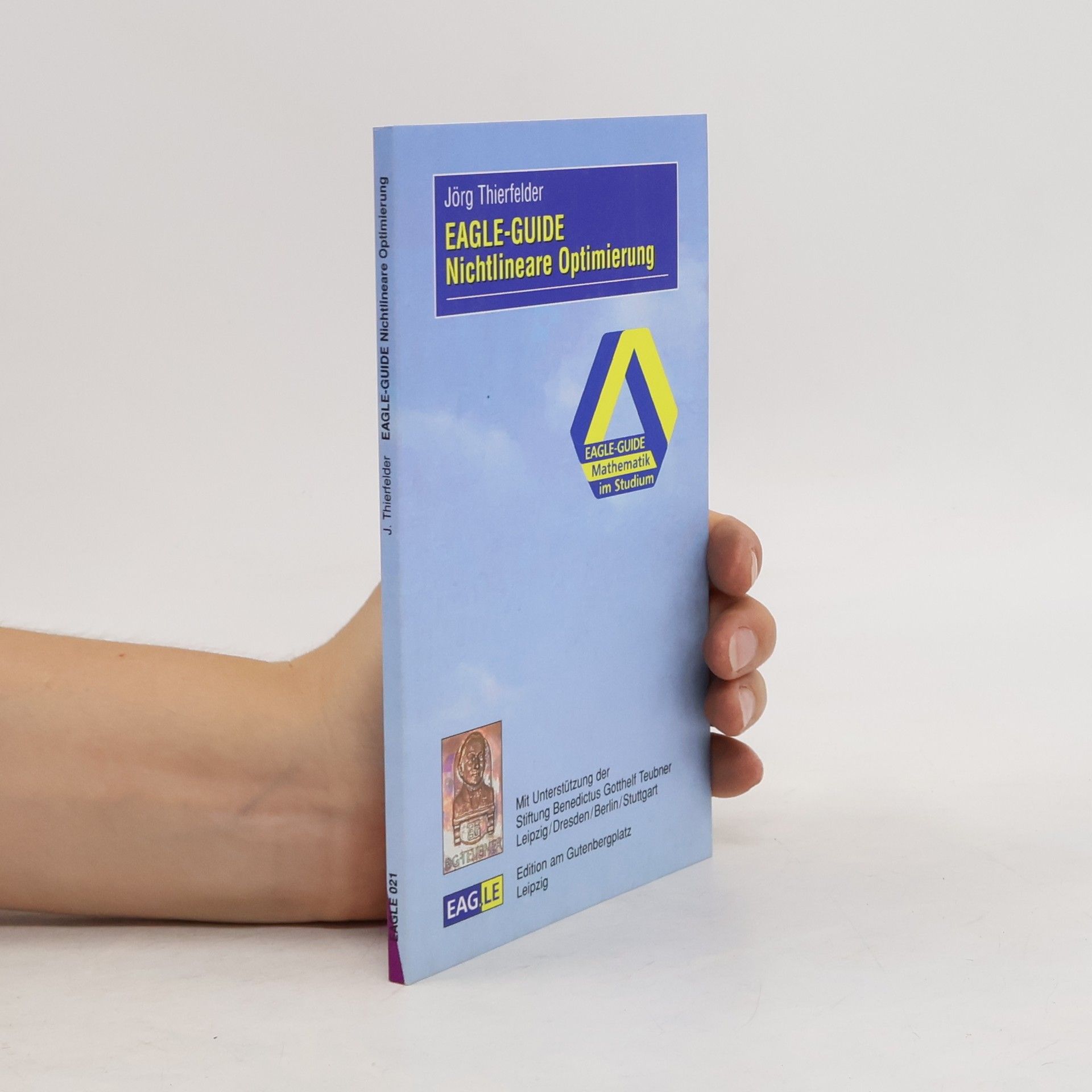
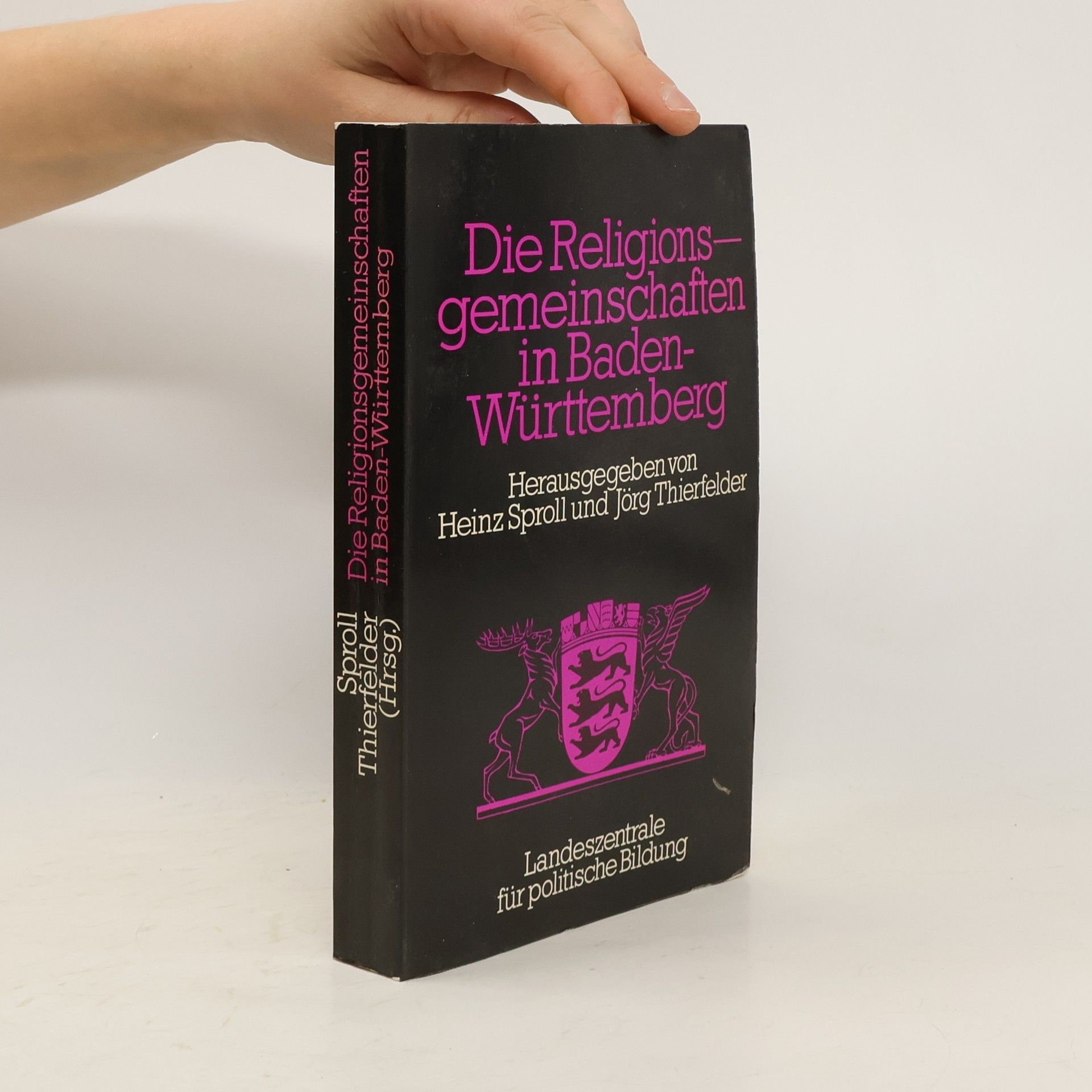
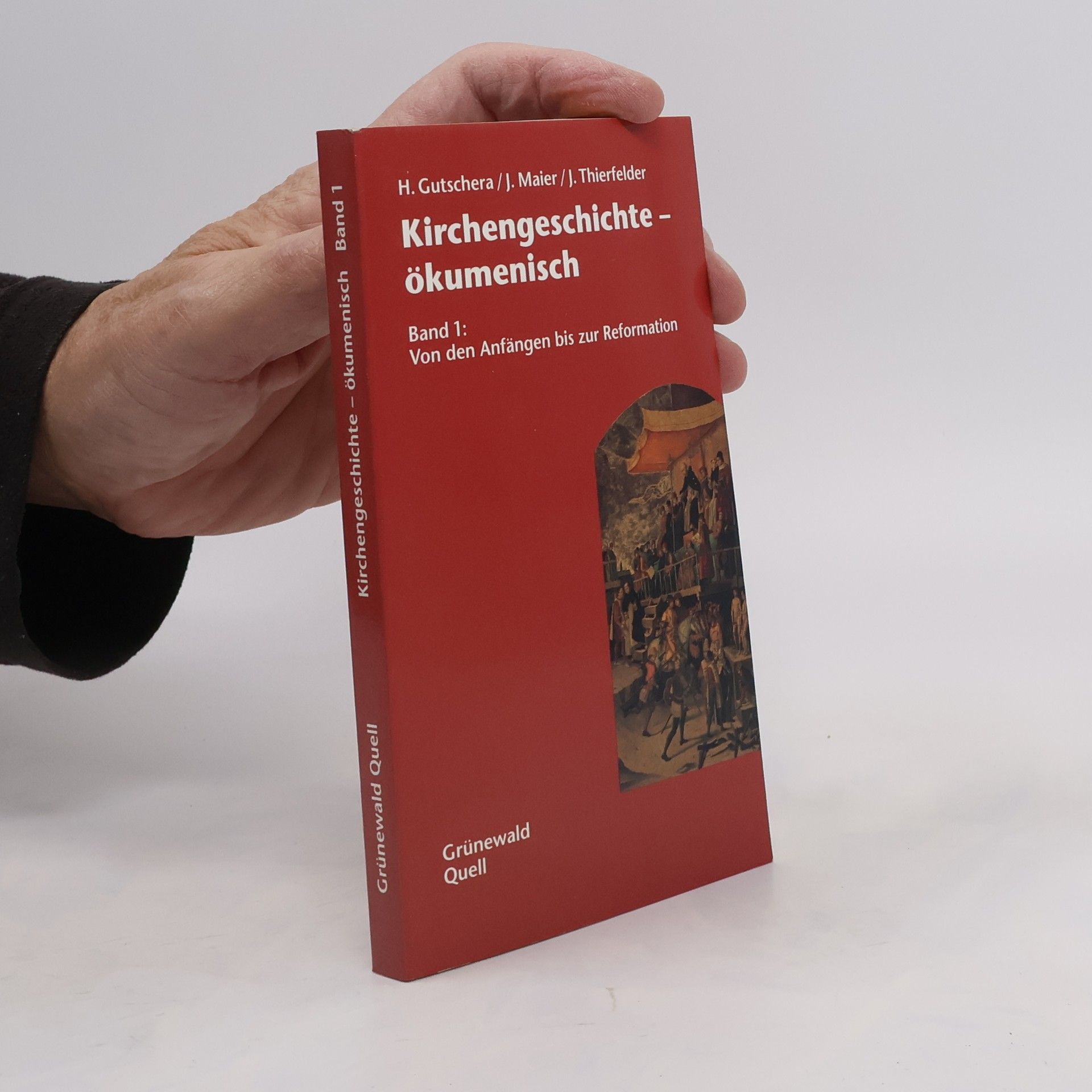
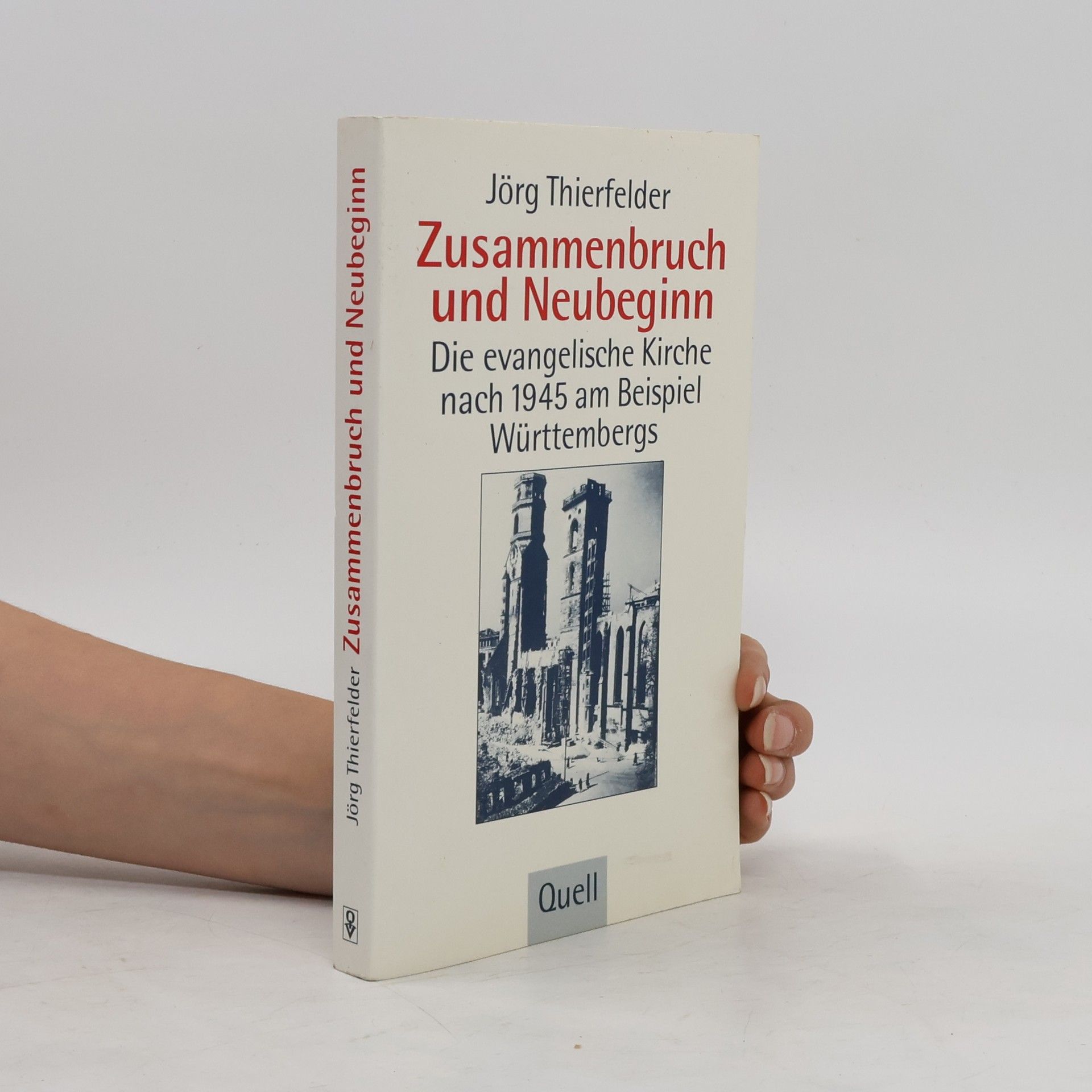

Das Rauschen der Zeit und die Stimme unseres Gottes
Die Karlshöher Brüderschaft in der Zeit des Dritten Reiches: Eine Dokumentation
- 303pagine
- 11 ore di lettura